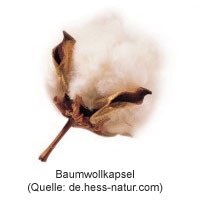Produktpalette/Non-Food-Produkte
Vorheriges Kapitel: 4.3 Convenience-Produkte
Contents
- 1 4.4 Non-Food-Produkte
- 1.1 Inhalt
- 1.2 4.4.1 Naturkosmetik
- 1.3 4.4.1.1 Rohstoffe
- 1.4 4.4.1.2 Produkte und Hersteller
- 1.5 4.4.1.3 Vermarktung
- 1.6 4.4.1.4 Richtlinien für Naturkosmetik
- 1.7 4.4.1.4.1 Österreichischer Lebensmittelcodex
- 1.8 4.4.1.4.2 "Kontrollierte Naturkosmetik" - eine privatrechtliche Richtlinie
- 1.9 4.4.2 Naturtextilien
- 1.10 4.4.2.1 Rohstoffe
- 1.11 4.4.2.1.1 Pflanzenfarben
- 1.12 4.4.2.1.2 Bio-Baumwolle
- 1.13 4.4.2.2 Produkte und Hersteller
- 1.14 4.4.2.3 Vermarktung
- 1.15 4.4.2.4 Richtlinien für Naturtextilien
4.4 Non-Food-Produkte
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Produkte und Rohstoffe aus Biologischem Anbau werden nicht nur für Lebensmittel verwendet. Auch in anderen Bereichen - Bekleidung, Körperpflege und Kosmetik, Waschen und Reinigen - gibt es gesunde und umweltverträgliche Alternativen zu herkömmlichen Produkten des täglichen Bedarfs. Besonders umfangreich ist die Produktpalette und die Zahl der Herstellerfirmen im Bereich der Naturkosmetik und der Naturtextilien.
Anders als im Lebensmittelbereich durch die EU-VO 2092/91[1] sind bei Naturkosmetika und Naturtextilien die Produktionsrichtlinien nicht gesetzlich verbindlich geregelt. Die Regelung und Kontrolle der Weiterverarbeitung ist hier wesentlich komplizierter als bei Lebensmitteln, da - vor allem bei den Textilien - mehrstufige, komplexere und auf viele Unternehmen aufgeteilte Produktionsschritte vorliegen. Es gibt jedoch auf privatrechtlichen Richtlinien und Kontrollen beruhende Prüfzeichen.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2.1
Inhalt
4.4.1 Naturkosmetik
Warum Naturkosmetik? Substanzen, die wir auf die Haut auftragen, werden vom Körper aufgenommen. Gesundheitsgefährdende Substanzen in Kosmetika sind daher ebenso problematisch wie Schadstoff- und Pestizidrückstände in Lebensmitteln. Herkömmliche Kosmetika können z.B. Substanzen enthalten, die Allergien auslösen können, krebsverdächtig sind oder vom Körper nicht abgebaut werden. Kosmetika können durch die Verwendung von Rohstoffen aus gentechnisch veränderten Pflanzen gentechnisch veränderte Bestandteile enthalten. Durch aufwändige Verpackung und durch die Verwendung von Erdöl als Ausgangsprodukt für synthetisch hergestellte Rohstoffe trägt auch die Kosmetikindustrie zur Umweltverschmutzung bei. Ein ethisches Problem stellen Tierversuche für Kosmetika bzw. deren Ausgangsprodukte dar.
Eine Alternative zur herkömmlichen Kosmetik bietet das ständig erweiterte und mittlerweile sehr umfangreiche Produktsortiment an Naturkosmetika. Unter Naturkosmetik versteht man Kosmetik aus natürlichen Rohstoffen pflanzlichen, tierischen oder mineralischen Ursprungs. Ausnahmen gibt es bei einzelnen Konservierungsstoffen, die verhindern sollen, dass die Produkte auch während des Gebrauchs nicht verderben. Synthetische Stoffe, die in der herkömmlichen Kosmetik eingesetzt werden (wie z.B. synthetische Farbstoffe, chemische UV-Filter, Paraffine, ...) und gentechnisch veränderte Rohstoffe werden nicht verwendet.
Quelle: Piringer und Hartl (o.J.)
4.4.1.1 Rohstoffe
Naturkosmetika bestehen mit wenigen Ausnahmen bei den Hilfsstoffen (bestimmte Konservierungsstoffe) aus natürlichen Rohstoffen pflanzlicher, tierischer und mineralischer Herkunft. Wichtige Rohstoffe sind Pflanzenöle und -fette (z.B. Jojobaöl, Wildrosenöl, Nachtkerzenöl, Sheabutter) und ätherische Öle, gewonnen z.B. aus Lavendel, Neroli und Rosmarin. Verwendet werden auch Pflanzenextrakte (Karottenextrakt, Mimosenblütenextrakt, ...) und Auszüge aus Kräutern und Wurzeln (Stiefmütterchen, Melisse, Iriswurzel, ... ). Hydrolate (das sind Nebenprodukte bei der Destillation von ätherischen Ölen) und Mazerate (Auszüge von Blüten und Kräutern in Basisölen) sind ebenfalls wichtige pflanzliche Rohstoffe. Tierische Rohstoffe sind z.B. Bienenwachs, Propolis und Honig.
4.4.1.2 Produkte und Hersteller
Das Naturkosmetik-Produktsortiment umfasst:
- Dekorative Kosmetik (Make up, Lippenstift, Wimperntusche, ...)
- Gesichtspflege (Reinigungsmilch, Gesichtswässer, Anti-Ageing-Cremes, ...)
- Körperpflege (Duschgels, Massageöle, Badezusätze, ...)
- Sonnenpflege (Sonnenschutzcremes, Sun-Blocker, After-Sun-Lotions, ...)
- Haarpflege (Shampoos, Pflanzenhaarfarben, Haarspray, ...)
- Nagelpflege (Nagellack, Nagellackentferner, ...)
- Babypflege (Shampoos, Cremes, Öle, ...)
- Parfüms, Eau de Toilettes, Deodorants
- Aftershaves, Rasiercremen
- Zahnpasta
- Mückenschutz
Bekannte Naturkosmetikhersteller, deren Produkte auch in Österreich erhältlich sind, sind z.B. Weleda[1]], Logona[2]], Lavera[3]], Martina Gebhardt [4]und Primavera Life[5]. Als Beispiele für österreichische Produzenten seien die Firma Sanoll [6]aus Tirol oder die Steirische Firma Ringana[7] genannt.
Quelle: Piringer und Hartl (o.J.)
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.weleda.com/
[2] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.logona.com
[3] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.lavera.de
[4] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de
[5] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.primavera-life.de
[6] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.sanoll.at
[7] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.ringana.com
4.4.1.3 Vermarktung
Naturkosmetik ist in Naturkostläden[1], Bio-Supermärkten[2], Reformhäusern und Apothekenerhältlich. Es gibt auch einzelne Fachgeschäfte, die ausschließlich Naturkosmetik führen. Andere Vermarktungswege sind der Versandhandel über Kataloge oder internet, vereinzelt finden sich auch Produkte in Drogeriemärkten. Im konventionellen Handel ist es nicht leicht, in der Fülle des Angebotes von Produkten, die mit Begriffen wie "Pflanzlich", "Natürlich", "Kräuter" und üppigen Naturbildern werben, seriöse Naturkosmetik herauszufinden. Eine gute Beratung gibt es in Reformhäusern und Naturkosmetikfachgeschäften.
Quelle: Piringer und Hartl (o.J.)
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 5.3
[2] Siehe Kapitel 5.2.1
4.4.1.4 Richtlinien für Naturkosmetik
Gerade im Kosmetikbereich gibt es sehr viele Produkte, die mit Begriffen wie "Natur", "pflanzliche Wirkstoffe", "Kräuter", "Bio" und der entsprechend blumig-natürlichen Verpackungsgestaltung den Eindruck erwecken, Naturkosmetika zu sein. Eine EU-Richtlinie für Naturkosmetik ähnlich wie die VO (EWG) 2092/91[1] für Lebensmittel aus biologischem Landbau gibt es leider noch nicht. In Österreich ist jedoch im österreichischen Lebensmittelcodex[2] definiert, was mit dem Begriff "Naturkosmetik" bezeichnet und verkauft werden darf. Weiters gibt es das Gütesiegel "kontrollierte Naturkosmetik", das auf den privatrechtlichen Richtlinien eines deutschen Herstellerverbandes basiert. Beide Regelungen schreiben derzeit nicht zwingend, sondern "soweit als möglich" Rohstoffe aus biologischem Landbau vor.
Quellen: Piringer und Hartl (o.J.)
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2.1
[2] Siehe Kapitel 2.2
4.4.1.4.1 Österreichischer Lebensmittelcodex
Im österreichischen Lebensmittelcodex[1] (Österreichisches Lebensmittelbuch, Codexkapitel B 33 „Kosmetische Mittel“, Teilkapitel „Naturkosmetik“), wird der Begriff Naturkosmetik definiert und ein entsprechender Standard festgelegt. Nur Produkte, die diesen Standards entsprechen, dürfen als "Naturkosmetik" bezeichnet werden.
Die wesentlichen Kriterien sind zusammengefasst:
- Naturkosmetika bestehen (mit wenigen Ausnahmen bei Hilfsstoffen) aus natürlichen Rohstoffen pflanzlichen, tierischen und mineralischen Ursprungs. Die Rohstoffe sollen so weit als möglich aus biologischem Anbau stammen.
- Als Hilfsstoffe sind nur bestimmte im Codex aufgelistete Konservierungsmittel, sowie aus natürlichen Rohstoffen hergestellte Emulgatoren und Tenside zugelassen. Konservierungsmittel sind deshalb erlaubt, damit die Produkte nicht nur im originalverpackten Zustand, sondern auch während des Gebrauchs nicht verderben.
- Bei den Verarbeitungsmethoden gibt es Einschränkungen: erlaubt sind nur physikalische, mikrobiologische und enzymatische Verfahren. Gentechnische Verfahren und die radioaktive Bestrahlung von Rohstoffen und Endprodukten sind verboten.
- Der Einsatz von synthetischen Duftstoffen, synthetischen Farbstoffen, Silikonen und ethoxilierten Rohstoffen ist verboten.
Quellen: Piringer und Hartl (o.J.)
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2.2
4.4.1.4.2 "Kontrollierte Naturkosmetik" - eine privatrechtliche Richtlinie
Der deutsche Herstellerverband BDIH (Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflege) entwickelte die Richtlinie und das Prüfzeichen "kontrollierte Naturkosmetik". Die Einhaltung wird von einem unabhängigen Prüfinstitut kontrolliert und auf den Produkten mit dem Zeichen des BDIH dokumentiert.
In einigen Punkten sind die Anforderungen der Richtlinie höher als im Teilkapitel Naturkosmetik des Österreichischen Lebensmittelcodex. So sind z.B. weniger Konservierungsstoffe zugelassen. Nicht erlaubt sind außerdem Stoffe die von toten Wirbeltieren stammen. Andererseits sind Verfahren erlaubt, die im Codex nicht enthalten sind, z.B. die Hydrierung als Verfahren zur Herstellung von Emulgatoren und Tensiden aus Naturstoffen. Die Unterschiede sind jedoch nicht gravierend.
Quellen: Piringer und Hartl (o.J.), www.kontrollierte-naturkosmetik.de[1]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de
4.4.2 Naturtextilien
Die Herstellung herkömmlicher Textilien ist ein komplexer, auf viele Verarbeitungsschritte und Produktionsstandorte aufgeteilter Prozess. Vor allem der hohe umwelt- und gesundheitsschädigende Chemikalieneinsatz in der konventionellen Baumwollproduktion und in der Textilveredlung wird von Umweltschutz- und Konsumentenschutzorganisationen kritisiert. Durch die stark arbeitsteilige, globale Produktionsweise ist das Transportaufkommen sehr hoch.
Auch soziale Mißstände kennzeichnen die textile Produktionskette. Organisationen wie die Clean Clothes Campagne[1]bemühen sich um eine Verbesserung der miserablen Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie der Schwellen- und Entwicklungsländern. Naturtextilien sind eine Alternative zu dieser wenig umwelt- und sozialverträglichen Produktionsweise.
Naturtextilien sind Textilien aus Naturfasern, deren Anbau und Weiterverarbeitung bestimmten Kriterien entspricht. Synthetikfasern werden außer in Ausnahmefällen, wie z.B. Elastan in Damenstrumpfhosen, nicht eingesetzt. Da die Textilherstellung ein komplexer Produktionsprozess ist, in dem bei herkömmlichen Textilien sehr viel "Chemie" eingesetzt wird, ist es notwendig die Verarbeitungsprozesse nach umweltverträglichen und gesundheitsverträglichen Kriterien zu definieren.
Quelle: Hartl und Vogl 2001
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.cleanclothes.org
4.4.2.1 Rohstoffe
Der mengenmäßig bedeutendste Faserrohstoff, der in Bio-Qualität für Naturtextilien verwendet wird, ist Bio-Baumwolle. Eine Besonderheit ist die farbig gewachsene Baumwolle - Baumwolle, deren Fasern nicht weiß, sondern in verschiedenen Braun- und Grüntönen ausgebildet sind.
Andere Fasern, die bereits in Bio-Qualität erhältlich sind und für Naturtextilien verwendet werden, sind Leinen, Hanf, Schafwolle, Cashmere und Seide.
Der Großteil der Naturtextilien ist mit synthetischen Farben gefärbt. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, Farbstoffe aus Pflanzen zu gewinnen. Der Anteil an pflanzengefärbten Textilien ist aber nach wie vor sehr gering.
Quelle: Hartl und Vogl 2001
4.4.2.1.1 Pflanzenfarben
Unter Pflanzenfarben versteht man Farbstoffe, die aus Pflanzen gewonnen werden. Der Anbau, die Farbstoffgewinnung und die Färberei mit Pflanzenfarben war vor der Erfindung der synthetischen Farben Mitte des 19. Jahrhunderts ein nicht unbedeutender Wirtschaftszweig. Bekannt ist vor allem Indigoblau, das aus dem subtropisch-tropischen Indigostrauch, dem japanischen Färberknöterich oder auch dem im Europa früher kultivierten Färberwaid hergestellt wurde. Rote Farbe wurde aus den Wurzeln des Färberkrapp gewonnen. Gelbe Farbstoffe sind in vielen Pflanzen enthalten, in Europa war die Färberresede am bedeutendsten.
Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es Forschungsprojekte, die die Wiedereinführung des Anbaus und der Färbung mit Färbepflanzen zum Ziel haben. Geforscht wird zu Anbauverfahren, Selektion von Pflanzen, Farbstoffextraktionsmethoden und industriellen Färbemethoden. Der Sprung in die Umsetzung und Anwendung in der Praxis im industriellen Maßstab ist noch nicht geschafft. Derzeit sind pflanzengefärbte Produkte aus kunsthandwerklicher Herstellung erhältlich.
Quelle: Hartl und Vogl 2001
4.4.2.1.2 Bio-Baumwolle
Die Baumwolle ist mengenmäßig die bedeutendste Naturfaser zur Herstellung von Bekleidung. Trotz des natürlichen Images der Baumwolle ist die herkömmliche Produktionsweise des Rohstoffs mit schwerwiegenden negativen Folgen für Mensch und Umwelt verbunden. Kritisiert wird vor allem der hohe Pestizideinsatz, der zu Vergiftungs- und Todesfällen bei den Bauern führt, Wasser und Nahrungsmittelkulturen kontaminiert und das natürliche Artenspektrum verändert. Weiter Folgen des Baumwollanbaus sind der hohe Wasserverbrauch, der Verlust an Biodiversität und an Anbauflächen für Nahrungsmittel durch den Anbau in Monokultur, der Verlust von Bodenfruchtbarkeit und das Auftreten von Erosionsschäden.
Die Anzahl an Biobaumwollproduzenten und Umstellungsprojekten steigt. Dies zeigt, dass ein nachhaltiger Anbau von Baumwolle im biologischen Landbau möglich und auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Die Hauptproduktionsländer von Biobaumwolle sind derzeit Türkei und USA. Weitere wichtige Länder sind Indien, Peru, Uganda, Ägypten, Senegal und Tansania. Trotzdem ist Bio- Baumwolle nach wie vor ein Nischenprodukt: erst weniger als 0,1% der Baumwollproduktion insgesamt stammen aus biologischem Anbau.
Die Förderung des biologischen Baumwollanbaus hat sich der Arbeitskreis Organic Cotton des Pestizid Aktions-Netzwerks (PAN Germany[1]) zum Ziel gesetzt. Zu den Aktivitäten dieses Arbeitskreises gehören:
- Beratung von Firmen und Organisationen, die auf Bio-Baumwolle umstellen wollen
- Betreuung einer Datenbank von Produzenten, Hersteller und Handelsunternehmen von Bio- Baumwolle bzw. Bio-Baumwoll-Produkten
- Seminare, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Baumwolle, Naturtextilmarkt und - labels
- Netzwerkarbeit und Organisation von Tagungen
Quellen: Hartl und Vogl 2001, Enquete-Kommission des deutschen Bundestages 1994, Ton 2002, www.pan-germany.org
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.pan-germany.org
4.4.2.2 Produkte und Hersteller
Das Produktsortiment von Naturtextilien ist sehr umfangreich und umfasst alle Bereiche der herkömmlichen Textilien:
- Damen- und Herrenmode
- Baby- und Kindermode
- Unterwäsche
- Nachtwäsche
- Heimtextilien und Bettwaren
- Accessoires
- Schuhe und Lederwaren
Bekannte Naturtextilhersteller sind z.B. Consequent[1]] oder Sekem[2]. In Deutschland findet zweimal jährlich eine eigene Fachmesse für Naturtexilien, die InNaTex[3] (Internationale NaturTextilmesse) statt.
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.consequent.org
[2] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.sekem.com
[3] https://web.archive.org/web/2005*/http://innatex.de
4.4.2.3 Vermarktung
In Österreich sind Naturtextilien schwer erhältlich. Der konventionelle Textilhandel führt Naturtextilien nicht. Die Auswahl an spezialisierten und kompetenten Naturtextilfachgeschäften ist gering. Ein paar Geschäfte gibt es in Wien, Perchtoldsdorf, Linz, Salzburg, Graz und Hohenems. Naturkostläden bieten - wenn überhaupt - nur ein sehr kleines Sortiment von Wäsche oder Babybekleidung.
Ein großes Angebot von Naturmode gibt es über den Versandhandel. Eine seit vielen Jahren marktführende und innovative Firma ist der deutsche Versandhandel hess natur[1], der auch nach Österreich liefert.
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://at.hess-natur.com
4.4.2.4 Richtlinien für Naturtextilien
Eine EU-weite Regelung wie die EU-VO 2091/92[1] im Lebensmittelbereich gibt es für Naturtextilien noch nicht, wohl aber privatrechtliche Regelungen und Prüfzeichen, die von unabhängigen Kontrollinstitutionen vergeben werden. Seriöse Prüfzeichen sind "Naturtextil IVN zertifiziert" und "Naturtextil IVN zertifiziert best" vom Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft[2] (IVN).
Die Richtlinien des Internationalen Verbands der Naturtextilwirtschaft ' umfassen die gesamte Produktionskette vom Rohstoff bis zum Endprodukt. Sie definieren
- Art und Produktionsweise der Rohstoffe,
- Verfahren und Chemikalien, die in der Weiterverarbeitung eingesetzt bzw. nicht eingesetzt werden dürfen,
- Grenzwertregelungen für Schadstoffrückstände im Endprodukt sowie
- Sozialstandards für Arbeitsbedingungen.
Die Zertifizierung durch eine unabhängige Püfinstitution beruht auf regelmäßigen Betriebsprüfungen und stichprobenartigen Kontrollen der Ware (Rückstandsanalysen). Es wurde ein Prüfzeichen in zwei Abstufungen entwickelt: "Naturtextil IVN zertifiziert best" (blau) hat die höchsten Anforderungen, "Naturtextil IVN zertifiziert" (orange) hat etwas geringere Anforderungen hinsichtlich Rohstoffproduktion und Weiterverarbeitung. Bei den Faserrohstoffen z.B. sind bei "best" ausschließlich Rohstoffe aus biologischer Landwirtschaft bzw. Umstellung erlaubt. "IVN zertifiziert" schreibt nur bei Baumwolle bio-Qualität bzw. Umstellungsware vor und läßt bei den anderen Faserrohstoffen auch konventionell erzeugte zu.
Quelle: Hartl und Vogl 2001, www.naturtextil.com
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2.1
[2] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.naturtextil.com