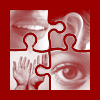Einfuehrung in die Methoden der Kultur- und Sozialanthropologie
Contents
- 1 Einführung in die empirischen Methoden der Kultur- und Sozialanthropologie
- 2 Kapitelübersicht
- 2.1 1 Die Herausbildung der kultur- und sozialanthropologischen Forschungsmethoden
- 2.2 1.1 Zur Institutionalisierung der Kultur- und Sozialanthropologie
- 2.3 1.1.1 Die Herausbildung ethnographischer Museen
- 2.4 1.1.2 Die Herausbildung anthropologischer Gesellschaften
- 2.5 1.1.3 Die universitäre Verankerung der Disziplin
- 2.6 1.2 Nationale Traditionen und unterschiedliche Bezeichnungen der Disziplin
- 2.7 1.3 Methoden der Kultur- und Sozialanthropologie vor der systematischen Feldforschung
- 2.8 1.3.1 Fragebögen der Armchair Anthropologists
- 2.9 1.3.2 Ausgewählte Expeditionen deutschsprachiger Forscher
- 2.10 1.3.3 Die Torres-Straits Expedition
- 2.11 1.4 Bronislaw Malinowski: Das klassische Modell der Feldforschung
- 2.12 1.4.1 Probleme des Feldeinstiegs
- 2.13 1.4.1.1 Feldforschung und die Rolle der nicht-indigenen Bevölkerung vor Ort
- 2.14 1.4.1.2 Feldforschung und mangelnde Sprachkenntnisse
- 2.15 1.4.1.3 Konkrete Beobachtungen als totes Material: Das Fehlen lokaler Interpretationen
- 2.16 1.4.2 Das Geheimnis der Feldforschung: methodische Grundlagen
- 2.17 1.4.2.1 Feldforschung als dauerhafte In-Beziehungsetzung zum Feld
- 2.18 1.4.2.1.1 Die Konstruktion des Feldes
- 2.19 1.4.2.2 Lernen vom Feld
- 2.20 1.4.2.3 Aktive Methoden
- 2.21 1.4.2.4 Induktion - Deduktion
- 2.22 1.4.2.5 Trennung von Empirie und Theorie
- 2.23 1.4.2.6 Die Suche nach Ordnung und Gesetzen
- 2.24 1.4.3 Drei zentrale methodische Verfahren
- 2.25 1.4.3.1 Das Skelett: die Dokumentation objektiver Daten
- 2.26 1.4.3.2 Das Fleisch: Teilnahme und Deskription des sozialen Lebens
- 2.27 1.4.3.3 Der Geist: die Sammlung charakteristischer Erzählungen
- 2.28 1.5 Literatur
- 2.29 2 Einige wissenschaftstheoretische Grundlagen der empirischen Sozialforschung
- 2.30 2.1 Methoden, Methodik und Methodologie
- 2.31 2.2 Der Positivismus
- 2.32 2.2.1 Neopositivismus und kritischer Rationalismus
- 2.33 2.2.2 Thomas Samuel Kuhn und die wissenschaftlichen Revolutionen
- 2.34 2.3 Nicht-positivistische wissenschaftstheoretische Ansätze in den Geistes- und Sozialwissenschaften
- 2.35 2.3.1 Die Hermeneutik
- 2.36 2.3.2 Der Pragmatismus
- 2.37 2.3.3 Die Phänomenologie
- 2.38 2.4 Emisch und etisch
- 2.39 2.5 Empiristen versus Rationalisten
- 2.40 2.6 Arten von Theorien
- 2.41 2.7 Begriffsbildung, Begriffsdefinitionen und Begriffsrelationen
- 2.42 2.7.1 Die Begriffsdefinition
- 2.43 2.7.1.1 Operationale Definition: Operationalisierung
- 2.44 2.7.2 Die Begriffsbildung
- 2.45 2.7.3 Die Begriffsrelationen
- 2.46 2.7.3.1 Klassifikation
- 2.47 2.7.3.2 Taxonomie
- 2.48 2.7.3.3 Typologie
- 2.49 2.7.4 Hypothesen
- 2.50 2.8 Literatur
- 2.51 3 Projektentwicklung: von der Idee zum Forschungsprojekt
- 2.52 3.1 Vom Interesse zur wissenschaftlichen Fragestellung
- 2.53 3.1.1 Spezifizierung des Phänomenbereichs
- 2.54 3.1.2 Literaturrecherche
- 2.55 3.1.2.1 zentrale Bibliothekskataloge
- 2.56 3.1.2.2 Verbundkataloge und Metasuchmaschinen
- 2.57 3.1.2.3 Zeitschriftenkataloge
- 2.58 3.1.2.4 Zeitschriftendatenbanken
- 2.59 3.1.2.5 andere Internetressourcen
- 2.60 3.2 Von der Fragestellung zum Forschungskonzept
- 2.61 3.2.1 Zentrale Inhalte von Forschungskonzepten
- 2.62 3.3 Kontexte eines Forschungsprojekts
- 2.63 3.3.1 Ethik der Forschung
- 2.64 3.3.1.1 Ethik gegenüber den Untersuchten
- 2.65 3.3.1.2 Ethik im Umgang mit Ergebnissen
- 2.66 3.3.1.3 Ethik gegenüber der wissenschaftlichen Gemeinschaft
- 2.67 3.3.1.4 Ethik gegenüber der Öffentlichkeit
- 2.68 3.3.1.5 Ethik gegenüber Sponsoren, Geld- und Arbeitsgebern
- 2.69 3.3.1.6 Ethik gegenüber Regierungen
- 2.70 3.3.1.7 The War against Terror und das Human Terrain System
- 2.71 3.4 Literatur
- 2.72 4 Forschungsablauf
- 2.73 4.1 Der lineare theorie- und hypothesenprüfende Forschungsablauf
- 2.74 4.2 Der zirkuläre theorieentwickelnde Forschungsablauf
- 2.75 4.3 Qualitätskriterien in der empirischen Sozialforschung
- 2.76 4.3.1 Quantitative Qualitätskriterien
- 2.77 4.3.2 Qualitative Qualitätskriterien
- 2.78 4.4 Literatur
- 2.79 5 Ausgewählte Weiterentwicklungen der ethnographischen Feldforschung
- 2.80 5.1 Ordnung vs. Konflikt: Die Extended-Case Method
- 2.81 5.2 Methodische Entwicklungen durch die Culture und Personality School
- 2.82 5.3 Dichte Beschreibung und interpretative Ethnographie
- 2.83 5.4 Postmoderne Kritik, literal turn und die Krise der Repräsentation
- 2.84 5.5 Globale Welt und multi-sited Ethnography
- 2.85 5.6 Transnationale Forschungen
- 2.86 5.7 Literatur
- 2.87 6 Strategien der Datenanalyse
- 2.88 6.1 Analyse der Fieldnotes
- 2.89 6.2 Inhaltsanalyse
- 2.90 6.2.1 quantitative Inhaltsanalyse
- 2.91 6.2.2 qualitative Inhaltsanalyse
- 2.92 6.2.2.1 Zusammenfassende Inhaltsanalyse
- 2.93 6.2.2.2 Explikative Inhaltsanalyse
- 2.94 6.2.2.3 Strukturierende Inhaltsanalyse
- 2.95 6.3 weitere ausgewählte Verfahren der Textanalyse
- 2.96 6.3.1 Strukturale Semiotik
- 2.97 6.3.2 Ethnographie des Sprechens - linguistische Anthropologie
- 2.98 6.3.3 Diskurs- und konverstationsanalytische Verfahren
- 2.99 6.3.3.1 historische Diskursanalyse
- 2.100 6.3.3.2 kritische Diskursanalyse
- 2.101 6.3.3.3 Einige methodische Anweisungen
- 2.102 6.3.3.3.1 Grob- und Feinanalysen
- 2.103 6.4 Literatur
Einführung in die empirischen Methoden der Kultur- und Sozialanthropologie
In verschiedenen Projekten, an denen das Institut für Kultur- und Sozialanthropologie beteiligt war, entstanden 2005 und 2006 hypermediale Lehr- und Lernunterlagen, die online genutzt werden können. 2019 wurden diese von Marlies Madzar und Clemens Schmid in ein aktuelles Wikiformat überführt. Für Anregungen, Hinweise und Kommentare, schreiben Sie bitte ein Mail an eksa.univie.ac.at
Verfasst von Ernst Halbmayer
Kapitelübersicht
1. Die Herausbildung der kultur- und sozialanthropologischen Forschungsmethoden
- 1.1 Zur Institutionalisierung der Kultur- und Sozialanthropologie
- 1.2 Nationale Traditionen und unterschiedliche Bezeichnungen der Disziplin
- 1.3 Methoden der Kultur- und Sozialanthropologie vor der systematischen Feldforschung
- 1.4 Bronislaw Malinowski: Das klassische Modell der Feldforschung
- 1.5 Literatur
2. Einige wissenschaftstheoretische Grundlagen der empirischen Sozialforschung
- 2.1 Methoden, Methodik und Methodologie
- 2.2 Der Positivismus
- 2.3 Nicht-positivistische wissenschaftstheoretische Ansätze in den Geistes- und Sozialwissenschaften
- 2.4 Emisch und etisch
- 2.5 Empiristen versus Rationalisten
- 2.6 Arten von Theorien
- 2.7 Begriffsbildung, Begriffsdefinitionen und Begriffsrelationen
- 2.8 Literatur
3 Projektentwicklung: von der Idee zum Forschungsprojekt
3.1 Vom Interesse zur wissenschaftlichen Fragestellung
3.1.1 Spezifizierung des Phänomenbereichs
3.1.2 Literaturrecherche
3.1.2.1 Zentrale Bibliothekskataloge
3.1.2.2 Verbundkataloge und Metasuchmaschinen
3.1.2.3 Zeitschriftenkataloge
3.1.2.4 Zeitschriftendatenbanken
3.1.2.5 andere Internetressourcen
3.2 Von der Fragestellung zum Forschungskonzept
3.2.1 Zentrale Inhalte von Forschungskonzepten
3.3 Kontexte eines Forschungsprojekts
3.3.1 Ethik der Forschung
3.3.1.1 Ethik gegenüber den Untersuchten
3.3.1.2 Ethik im Umgang mit Ergebnissen
3.3.1.3 Ethik gegenüber der wissenschaftlichen Gemeinschaft
3.3.1.4 Ethik gegenüber der Öffentlichkeit
3.3.1.5 Ethik gegenüber Sponsoren, Geld- und Arbeitsgebern
3.3.1.6 Ethik gegenüber Regierungen
3.3.1.7 The War against Terror und das Human Terrain System
3.4 Literatur
4 Forschungsablauf
4.1 Der lineare theorie- und hypothesenprüfende Forschungsablauf
4.2 Der zirkuläre theorieentwickelnde Forschungsablauf
4.3 Qualitätskriterien in der empirischen Sozialforschung
4.3.1 Quantitative Qualitätskriterien
4.3.2 Qualitative Qualitätskriterien
4.4 Literatur
5 Ausgewählte Weiterentwicklungen der ethnographischen Feldforschung
5.1 Ordnung vs. Konflikt: Die Extended-Case Method
5.2 Methodische Entwicklungen durch die Culture und Personality School
5.3 Dichte Beschreibung und interpretative Ethnographie
5.4 Postmoderne Kritik, literal turn und die Krise der Repräsentation
5.5 Globale Welt und multi-sited Ethnography
5.6 Transnationale Forschungen
5.7 Literatur
6 Strategien der Datenanalyse
6.1 Analyse der Fieldnotes
6.2 Inhaltsanalyse
6.2.1 quantitative Inhaltsanalyse
6.2.2 qualitative Inhaltsanalyse
6.2.2.1 Zusammenfassende Inhaltsanalyse
6.2.2.2 Explikative Inhaltsanalyse
6.2.2.3 Strukturierende Inhaltsanalyse
6.3 weitere ausgewählte Verfahren der Textanalyse
6.3.1 Strukturale Semiotik
6.3.2 Ethnographie des Sprechens - linguistische Anthropologie
6.3.3 Diskurs- und konverstationsanalytische Verfahren
6.3.3.1 historische Diskursanalyse
6.3.3.2 kritische Diskursanalyse
6.3.3.3 Einige methodische Anweisungen
6.3.3.3.1 Grob- und Feinanalysen
6.4 Literatur
1 Die Herausbildung der kultur- und sozialanthropologischen Forschungsmethoden
Die Kultur- und sozialanthropologischen Forschungs- und Arbeitsmethoden zeichnen sich durch einen großen Pluralismus und eine vergleichsweise lange Entwicklung aus. Diese Entwicklung erfolgte unter anderem entlang unterschiedlicher nationalsprachlicher Entwicklungslinien, so dass man z.B. von deutschsprachigen, britischen, französischen, US-amerikanischen aber auch russischen (u.a.) Traditionen innerhalb der Wissenschaftsdisziplin sprechen kann. (siehe Barth et al. 2005) Innerhalb dieser einzelnen Entwicklungslinien kam es zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch zu verschiedenen Auffassungen, was den Kern der Wissenschaftsdisziplin ausmacht. Dies kommt in unterschiedlichen methodischen Ausrichtungen und Auffassungen, wie Ethnographie zu betreiben sei, zum Ausdruck. Auf einer Metaebene zeigt sich diese Vielfalt auch in den unterschiedlichen Bezeichnungen der Disziplin[1], wie Anthropologie, Kulturanthropologie und Sozialanthropologie, aber auch in den Begrifflichkeiten Völkerkunde, Ethnologie bzw. Ethnographie, die aus jeweils unterschiedlichen Positionen und zu verschiedenen Zeitpunkten verwendet wurden.
Damit wird nicht nur eine Wissenschaftsdisziplin unterschiedlich bezeichnet, sondern es steht die Ausrichtung dieser Disziplin selbst zur Debatte. Was heute unter dem Begriff „Kultur- und Sozialanthropologie“ zusammengefasst wird, umfasst unterschiedliche fachliche Ausrichtungen, die sich u.a. rund um folgende Schnittstellen positionieren:
Eine Schnittstelle, nämlich jene zwischen Kultur- und Sozialwissenschaft, kommt bereits im Doppelnamen der Kultur- und Sozialanthropologie und ihrem jeweiligen Naheverhältnis zur britischen bzw. US-amerikanischen Tradition zum Ausdruck. Hier reproduziert sich die Differenz zwischen Kultur- und Sozialwissenschaften.
Eine zweite Schnittstelle kommt in der Frage zum Ausdruck, ob und in wie weit Kultur- und Sozialanthropologie primär an zeitlichen, diachronen Abfolgen und Entwicklungen interessiert ist und damit als eine historisch orientierte Wissenschaft verstanden werden kann, oder aber primär auf synchrone Analysen kultureller und sozialer Zusammenhänge zu bestimmten Zeitpunkten abstellt. Nach dem Evolutionismus des 19. Jahrhunderts spielte die historische Ausrichtung insbesondere in der deutschsprachigen Ethnologie (Diffusionismus, Kulturkreislehre, Ethnohistorie) und der US- amerikanischen Anthropologie (historischer Partikularismus) eine zentrale Rolle, während sich die britische und die französische Tradition auf unterschiedliche Art und Weise einem funktionalistischen bzw. strukturalistischen sozialwissenschaftlichen Paradigma verpflichtet fühlten.
Eine dritte Schnittstelle, die bis heute - insbesondere im US-amerikanischen Kontext – diskutiert wird, ist die prinzipielle Unterscheidung zwischen „scientists“ und „humanists“. Diese verweist auf die bereits von Dilthey eingeführte Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften und die damit einhergehende Differenz zwischen „harten“, an die Naturwissenschaften angelehnten Verfahren und Erklärungen und „weichen“, interpretativen und verständnisorientierten Methoden. Innerhalb der Kultur- und Sozialanthropologie kommt dieser Gegensatz auch in der Unterscheidung von emisch und etisch[2] zum Ausdruck.
Die jeweilige Positionierung des Faches bzw. einer Forschung entlang dieser Schnittstellen kommt nicht nur in unterschiedlichen theoretischen Orientierungen, sondern auch in der Methodik der wissenschaftlichen Vorgangsweise und den angewandten und eingesetzten methodischen Verfahren zur Fragenbeantwortung zum Ausdruck.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 1.2
[2] Siehe Kapitel 2.4
1.1 Zur Institutionalisierung der Kultur- und Sozialanthropologie
Die akademische Institutionalisierung der Kultur- und Sozialanthropologie (KSA) fand hauptsächlich im Laufe des 19. Jahrhunderts statt und vollzog sich auf drei Ebenen:
- anthropologischen Gesellschaften
- Museen
- der universitären Verankerung der Disziplin
Im Vergleich zu anderen Sozialwissenschaften (z.B. Soziologie, Politikwissenschaft, Publizistik), hat sich die KSA bzw. Völkerkunde früh als eigenständige Wissenschaftsdisziplin im akademischen Kontext etabliert.
Die frühe Relevanz der Kultur- und Sozialanthropologie stand insbesondere mit der europäischen Expansion und dem Kolonialismus in Zusammenhang und der damit einhergehenden Konfrontation, Transkulturation und (partiellen) Integration nicht-industrialisierter Gesellschaften in die sich herausbildende Weltgesellschaft. Im Gegensatz dazu fokussierte die Soziologie auf die sich industrialisierende euro-amerikanische Gesellschaft und den resultierenden Folgen des Kapitalismus, wie Landflucht, Verstädterung, Zuspitzung sozialer Gegensätze und die „soziale Frage“ des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
Die frühe Institutionalisierung der Völkerkunde lässt sich auch an der Universität Wien verdeutlichen. Von den Studienrichtungen, die heute an der Fakultät für Sozialwissenschaften angesiedelt sind, wurde die „Völkerkunde“ als erste universitär verankert. Bereits 1912 gab es an der Universität Wien eine Professur für Anthropologie und Ethnographie, die der Arzt Rudolf Pöch innehatte. 1929 kam es zur Trennung in 2 eigenständige Institute, in jenes für physische Anthropologie und in das Institut für Völkerkunde (siehe Geschichte des Instituts[1]).
Ein Vorläufer des heutigen Instituts für Publizistik und Kommunikationswissenschaften wurde 1939, also im Dritten Reich, als Institut für Zeitungswissenschaft gegründet. Für das Institut galt es im Allgemeinen - ganz im Sinne des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda, Goebbels - die "Dienstfähigkeit und Relevanz der Zeitungswissenschaft für die nationalsozialistische Presselenkung zu sichern." (Duchkowitsch 1989: 166).
Das Institut für Volkskunde wurde in Wien 1961 gegründet, davor bestand von 1939 bis 1945 das "Institut für germanisch deutsche Volkskunde", dessen Leiter Wolfram 1945 zwar suspendiert wurde, jedoch ab 1961 erneut die Professur am Institut für Volkskunde antrat.
Im Gegensatz dazu wurde der erste Lehrstuhl für Soziologie in Wien an der Fakultät für Rechts- und Staatswissenschaftern erst nach dem Krieg 1950 eingerichtet. Als eine eigenständige Studienrichtung existiert die Soziologie erst seit 1966.
Die Grundlage für das Fach der Politikwissenschaft entstand im Jahr 1968 mit einer ersten Professur für Philosophie der Politik- und Ideologiekritik am Institut für Philosophie, 1971 wurde ein Institut für Theorie der Politik gegründet.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/html/inh/inst/gesc.htm
1.1.1 Die Herausbildung ethnographischer Museen
Aus den ethnographischen Sammlungen, die im Rahmen von Expeditionen und kolonialistischen Unternehmungen zusammen getragen wurden und die Teil der so genannten Wunderkammern der Kaiser und Könige waren, wurden im Zuge des 19. Jahrhunderts eigene Museen gegründet, die auch für die Öffentlichkeit zugänglich wurden. Zu Beginn waren ethnographische Sammlungen oft noch Teil breiter angelegter naturhistorischer Museen, doch im Laufe der Zeit entstanden zunehmend eigene anthropologische Museen.
Wichtige früh etablierte anthropologische Museen waren zum Beispiel das 1849 gegründete Museum in Basel, das Königliches Museum für Völkerkunde in Berlin (1873) und das Wiener Museum für Völkerkunde[1]. Die Ursprünge des Museums für Völkerkunde Wien reichen ins Jahr 1806 zurück. Damals wurde mit dem Erwerb eines Teils der Cookschen Sammlungen eine eigene "k.k. Ethnographische Sammlung" im kaiserlichen Hofnaturalienkabinett eingerichtet. Seit 1876 wurden die Bestände in der Anthropologisch- Ethnographischen Abteilung des Naturhistorischen Museums verwaltet. 1928 erfolgte schließlich die Gründung eines eigenen Museums für Völkerkunde, welches nun Teil des Kunsthistorischen Museums ist.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.khm.at/museum-fuer-voelkerkunde
1.1.2 Die Herausbildung anthropologischer Gesellschaften
Weiters kam es zur Gründung eigener anthropologischer Gesellschaften. Einige prominente Vereinigungen sind etwa:
- die Société des Observateurs de l´Homme (1799) und die Société Ethnologique de Paris (1839) in Frankreich,
- die Aborigines Protection Society (1837), die Ethnological Society of London (1844) und die Anthropological Society of London (1863) in Großbritannien
- die Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Frühgeschichte[1] (1869) und die Anthropologische Gesellschaft[2] in Wien (1870) im deutschsprachigen Raum
- sowie die Anthropological Society of Washington (1879) in den USA.
Diese Gesellschaften vereinten Vertreter, die heute unterschiedlichen Fachdisziplinen angehören. Sie versammelten insbesondere physische Anthropologen und jene Gelehrten, die eher an Kultur und Gesellschaft interessiert waren. Die bis heute existierende anthropologische Gesellschaft in Wien, vereint in sich nach wie vor jene Disziplinen, deren Erkenntnissinteresse auf den Menschen gerichtet ist: physische Anthropologie, Ur- und Frühgeschichte, Volkskunde und Völkerkunde. Auch die größte Organisation von Fachvertretern die US-amerikanische American Anthropological Association[3] sieht "anthropology as the science that studies humankind in all its aspects, through archeological, biological, ethnological, and linguistic research." (AAA Statement of Purpose[4])
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.bgaeu.de/
[2] http://www.nhm-wien.ac.at/ag/
[3] http://www.aaanet.org
[4] http://www.aaanet.org/about/Governance/Satement-of-Purpose.cfm
1.1.3 Die universitäre Verankerung der Disziplin
Darüber hinaus kam es zur Etablierung eigener anthropologischer Lehrstühle und Institute innerhalb der Universitäten. 1869 wurde in Berlin Adolf Bastian (1826 – 1905) der erste Universitätsdozent für Völkerkunde in Deutschland. Edward B. Tylor erhielt 1883 den ersten anthropologischen Universitätsposten im Vereinigten Königreich an der Universität von Oxford, wo er 1895 zum Professor für Anthropologie wurde. Der Deutsche Franz Boas[1] erhielt seine erste akademische Position in den USA an der Clark University in Worcester Mass. 1896 wurde er Lektor für physische Anthropologie und 1899 Professor für Anthropologie an der Columbia University.
In den USA wurden hauptsächlich allgemeine Anthropologiedepartments gegründet, die sich am so genannten „four field approach“ orientierten und die zum Teil bis heute die Fächer Kulturanthropologie, Linguistik, physische Anthropologie und Archäologie verbinden. Im Allgemeinen ist es aber zu einer disziplinären Trennung zwischen der physischen Anthropologie (Humananthropologie) und der Kultur- und Sozialanthropologie gekommen. Die Situation im deutschsprachigen Raum zeichnet sich darüber hinaus durch eine Trennung von Volks- und Völkerkunde aus. Die Trennung von Volks- und Völkerkunde ist eine Folge der Romantik (Herder: Natur- und Kulturvölker) u. des deutschen Nationalismus: In der Volkskunde stand lange Zeit die Beschäftigung mit den eigenen ländlichen Wurzeln, der eigenen Kultur, von Bräuchen, der Sprache und der Sammlung von Märchen (Gebrüder Grimm), Volksliedern, materieller Kultur etc. im Zentrum.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-54.html
1.2 Nationale Traditionen und unterschiedliche Bezeichnungen der Disziplin
Der Terminus "Ethnographie" wurde ursprünglich als Analogie zu "Geographie" konzipiert und meint "Völkerkunde" im Gegensatz zur "Erdkunde".
Das Konzept der Aufklärung sah Ethnographie u. Völkerkunde als synonyme Begriffe für eine empirisch basierte akademische Wissenschaft der Kulturen, Sprachen und Völker der Erde.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff Ethnographie auf eine rein deskriptive Bedeutung reduziert und in Opposition zur theoretisch orientierten Ethnologie konzipiert.
Als damit verbundene Entwicklung änderte sich im späteren 19. Jahrhundert auch die Bedeutung von Völkerkunde, die nun Ethnographie und Ethnologie in sich vereinte.
In den letzten Jahrzehnten setzen sich - auch vor dem Hintergrund des problematischen und belasteten Begriffs des Volkes - innerhalb des deutschsprachigen Raums zunehmend die Bezeichnungen "Kultur- und Sozialanthropologie" durch. Diese beziehen sich auf die englischsprachigen Bezeichnungen "Social Anthropology" und "Cultural Anthropology", welche ursprünglich mit der britischen Sozialanthropologie und der US-amerikanischen Kulturanthropologie in Zusammenhang stehen. Während in der britischen Tradition die Sozialanthropologie als Teil der Sozialwissenschaften, insbesondere der Soziologie verstanden wurde, verstand sich die US-amerikanische Kulturanthropologie als Teil der Anthropologie, welche im Sinne des so genannten "four field approach" neben kultureller Anthropologie auch Archäologie, Linguistik und physische Anthropologie mit einschließt.
1.3 Methoden der Kultur- und Sozialanthropologie vor der systematischen Feldforschung
Im Allgemeinen war die Kultur- und Sozialanthropologie in ihren Anfängen von einer grundlegenden personellen Arbeitsteilung zwischen Datensammlern und Theoretikern geprägt, zwischen jenen, die ins Feld gingen und eigenständig vor Ort Daten erhoben und den so genannten armchair anthropologists, die daheim aus dem gesammelten Material ihre theoretischen Schlüsse zogen.
Die Anthropologen stützten sich am Beginn vor allem auf Berichte und Beschreibungen von Missionaren, Händlern, Reisenden und Verwaltungsbeamten, die ihre Informationen über außereuropäische Kulturen zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert größtenteils unsystematisch sammelten. Aus dem Blickwinkel der Europäer wurden dabei insbesondere "sonderbare Bräuche" der angetroffenen Indigenen festgehalten. In diesen Beschreibungen, die meist auf Basis kurzer Begegnungen mit fremden Kulturen entstanden, wurde oftmals das Exotische und Sonderbare ausführlich dargestellt und die indigenen Kulturen häufig mit der eigenen Kultur der Forscher in einer hierarchisierenden und (ab)wertenden Weise verglichen.
Einen grundlegenden Schritt zur Entwicklung einer systematischen Feldforschung innerhalb der Kultur- und Sozialanthropologie bilden die Expeditionen der Aufklärung, bei denen systematisch wissenschaftliche Daten erhoben wurden (etwa im Zuge der 2. Cook-Reise, den Forschungsreisen von Alexander von Humboldt oder der österreichischen Brasilien-Expedition). Solche Expeditionen leisteten auch einen zentralen Beitrag zur Methodenentwicklung, wie etwa die britische Torres-Straits Expedition.
1.3.1 Fragebögen der Armchair Anthropologists
Eine wichtige Rolle in der systematischen ethnographischen Datenerhebung die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts durchsetzt, spielten Fragebögen, die anthropologische Gesellschaften und Experten wissenschaftlichen Forschungsexpeditionen und auch Reisenden und Verwaltungsbeamten mitgaben, damit diese gezielter Daten erheben konnten. Die frühe Anthropologie sah es unter anderem als ihre Aufgabe Informationen über andere Kulturen zu sammeln, bevor diese aussterben. Eine grundlegende Strategie dabei war „ to send out comprehensive lists of queries in the form of questionnaires“ (Urry 1984: 38).
Die bekanntesten Anweisungen zur Erhebung ethnographischen Datenmaterials im 19. Jahrhundert waren die vom Royal Anthropological Institute herausgegebenen Notes and Queries on Anthropology, for the Use of Travellers and Residents in Uncivilized Lands (1. Ausgabe 1874), welche der Verbesserung der wissenschaftlichen Qualität der Berichte von Missionaren, Forschern und Beamten des britischen Königreichs dienen sollten (Barth et al. 2005: 10). In den USA basierte L. H. Morgans Werk Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family auf Erhebungen mit dem von ihm entworfenen Circular in reference to the degree of relationship among different nations (1862) zur Verwandtschaftsterminologie, der vom Smithsonian Institute in Washington herausgegeben wurde.
Durch diese Fragebogenerhebungen von Missionaren, Händlern, Reisenden, Expeditionsteilnehmern und Verwaltungsbeamten entstand reichhaltiges ethnographisches Material und damit auch die Erkenntnis, dass "primitive" Kulturen weit komplexer sind als bis dahin angenommen. Dies führte auch auf theoretischer Ebene dazu, dass man sich von generellen Theorien der Evolution entfernte und das Interesse nun zunehmend auf die spezielle Entwicklung einzelner Kulturen in bestimmten Weltregionen legte.
Zur selben Zeit begannen die Gelehrten zu realisieren, dass die Qualität vieler dieser ethnographischen Beschreibungen, die via Fragebogenerhebungen von Mittelsmännern vor Ort entstanden, unzureichend waren und sie eventuell selbst die Daten erheben sollten.
Trotz der Aufteilung zwischen armchair anthropologists und "Laiensammlern" in den Anfängen der anthropologischen Disziplin, gab es auch Personen, die zu den anthropologischen Experten hinzugezählt werden und selbst Daten erhoben haben. Vor allem in der deutschsprachigen und der amerikanischen Forschungstradition wurden seit den Anfängen eigenständig ethnographische Daten erhoben. So zum Beispiel im deutschsprachigen Raum von Adolf Bastian während seiner Tätigkeit als Schiffsarzt auf Reisen nach Indien, Australien, Afrika, Peru, Mexiko und in die Karibik.
In den USA entwickelte sich die Anthropologie mit einem besonderen Interesse für den Ursprung, die Entwicklung und die Beziehungen der Indigenen Kulturen Amerikas. Die Forschung war schon seit den Anfängen durch den unmittelbaren Kontakt mit den Indigenen und durch eigenständige Datenerhebung geprägt (wie z.B. Lewis Henry Morgans Ethnographie "The League of the Ho-de- no-sau-nee or Iroquois" (1851)). Bei der Sammlung von ethnographischem Material wurden in der amerikanischen Tradition auch indigene Informanten eingesetzt und ein großes Augenmerk auf linguistische Daten (Wortlisten u. Grammatik, Sammlung von Texten) gelegt.
Diese Betonung von Sprache setze sich auch mit der Entstehung der professionellen Anthropologie fort und spiegelt sich in der Arbeit von Franz Boas wieder, der beeinflusst von der deutschsprachigen ethnographischen Tradition die breite Institutionalisierung der Anthropologie in den USA initiierte. Boas strebte nach intensiver Forschung in individuellen Kulturen mit dem Ziel ethnographisches Material zu produzieren, das den Geist der beforschten Völker widerspiegelt. Boas argumentiert „for accounts which showed what `the people ... speak about, what they think and what they do´ recorded by the ethnographer in `their own words´” (Urry 1984: 43). Dies ist nur durch das Sammeln von Artefakten und extensives Festhalten von Texten in der indigenen Sprache möglich. Seiner Meinung nach mussten, bevor große Theorien entwickelt werden können, Rohdaten gesammelt werden, wobei er die von ihm angewandten Methoden der Datenerhebung nie explizit machte. Unter "Methode" verstand Boas hauptsächlich Analyse- und nicht Erhebungs- bzw. Feldmethoden.
1.3.2 Ausgewählte Expeditionen deutschsprachiger Forscher
Für den deutschsprachigen Raum relevante Forschungsreisende sind Johann Reinhold Forster (1729- 1798) und sein Sohn Georg Forster (1754-1794), die an James Cooks 2. Expedition teilnahmen. Aus dieser Entdeckungsreise gingen klare, großteils vorurteilsfreie, reichhaltige Reiseberichte hervor, die Georg Forster als „A voyage around the world“ (1777) publizierte. Die von den Forsters gesammelten ethnographischen Objekte bildeten die Grundlage für verschiedene anthropologische Museen[1] in ganz Kontinentaleuropa (Göttingen, Wien, Florenz). Auch Alexander von Humboldt sammelte während seiner 5-jährigen Reise durch Süd- und Zentralamerika 1799-1804 reichhaltiges Material, das er in einem 30-bändigen Werk verarbeitete. Weitere Forschungsexpeditionen führten ihn auch nach Sibirien und Russland.
Aus österreichischer Sicht relevant ist die von Kaiser Franz I. initiierte Brasilien-Expedition (1817-1835). Auf Grund der Heirat seiner Tochter Leopoldine mit dem im brasilianischen Exil lebenden portugiesischen Prinzen Pedro, später Kaiser von Brasilien, veranlasste er diese Forschungsreise mit dem Ziel, die noch unerforschten Gebiete Brasiliens zu bereisen und Sammlungen für die kaiserlichen Museen und Botanische Gärten anzulegen. Das Forscherteam bestand u.a. aus dem Zoologen Johann Natterer, der während seines 18- jährigen Forschungsaufenthaltes (1817- 1835) unzählige naturkundliche Objekte, aber auch Ethnographica indigener Kulturen Brasiliens sammeln konnte. Ein Großteil der naturkundlichen Objekte befindet sich im Naturhistorischen Museum in Wien. Auch die 1800 Objekte umfassende ethnographische Sammlung Natterer des Völkerkundemuseums in Wien ging aus dieser Forschungsexpedition hervor. Sie ist die weltweit bedeutendste historische Sammlung von ethnographischen Objekten verschiedener indigener Ethnien Brasiliens. Der Großteil der Aufzeichnungen Natterers über die indigenen Kulturen Brasiliens verbrannte während der Revolution 1848. Spix und Martius, die als Vertreter des bayrischen Hofes an der Expedition teilnahmen und von 1817-1820 in Brasilien forschten, wurden zu Begründern der Brasilianischen Anthropologie.
Weiters wichtig vor allem für die Ethnologie Südamerikas waren die frühen Expeditionen von Karl von den Steinen und Theodor Koch-Grünberg.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 1.1.1
1.3.3 Die Torres-Straits Expedition
Foto: Torres-Straits ExpeditionFoto: Torres-Straits Expedition. Quelle: Museum of Archaeology & Anthropology
1898 initiierte der Zoologe und Meeresbiologe Alfred Cort Haddon, eine Expedition in die Torres Strait, die sich als zentral für die Entwicklung ethnographischer Techniken herausstellte (Urry 1984: 45). Ziel der Expedition war: „to study the anthropology, psychology, and sociology of „savage“ peoples by making careful inquiries in situ“ (Barth et al. 2005: 11).
Bereits 1888 hatte Haddon erste Forschungen auf den Inseln der Torres Straits durchgeführt, bei denen er auch anthropologische Fragebögen[1] einsetzte, um indigene Bräuche zu dokumentieren (die Notes and Queries des Royal Anthropological Institutes und James Frazers Fragebogen „Questions on the Customs, Beliefs and Languages of Savages“ 1887). Die Publikation dieser Forschungsergebnisse machte ihn auch zu einer zentralen Figur innerhalb der Anthropologie. Er prägte dadurch eine naturwissenschaftliche Orientierung der anthropologischen Forschungsmethoden.
Für die Torres-Straits Expedition von 1898 rekrutierte Haddon eine Forschergruppe, deren Mitglieder wenig bis gar keine Erfahrung mit der Anthropologie hatten. Das Forscherteam bestand aus dem Linguisten Sidney Ray, den Psychologen W.H.R. Rivers und dessen Assistenten McDougall, dem Anthropologen Anthony Wilkin, dem Musikwissenschafter Charles Samuel Myers und dem Pathologen Charles Seligman, der später den Lehrstuhl für Ethnologie an der Universität von London inne hatte. Die Torres-Straits Expedition kann als Wendepunkt für die britische Anthropologie gesehen werden:
Erstens kam es zu einer Entwicklung hin zu einer eigenständigen Erhebung der Daten durch die Wissenschafter vor Ort, anstatt der bis dahin vorherrschenden Datenextraktion aus schriftlichen Quellen. Die Feldforschung als zentrales Mittel der Datenerhebung wurde aufbauend auf den Erfahrungen der Torres-Straits Expedition von Malinowski weiter entwickelt und mit ihm endgültig in der britischen anthropologischen Tradition verankert.
Zweitens wurde nicht mehr generell Kultur als Objekt der anthropologischen Forschung gesehen, sondern man fokussierte auf spezielle lokale Gemeinschaften.
Drittens kam es zur Entwicklung neuer Methoden, wobei insbesondere Rivers genealogische Methode der Verwandtschaftsethnologie zu nennen ist.
Mit W.H.R. Rivers und Charles G. Seligman gingen aus der Expedition zwei Schlüsselfiguren für die nächste Generation der Anthropologie in Großbritannien hervor. Sie selbst hatten jedoch noch keine akademische anthropologische Ausbildung genossen (Barth et al. 2005: 13).
Das Problem der Methode war für Rivers und seine Generation von Anthropologen zentral, nur durch eine klare wissenschaftliche Vorgangsweise und systematische Terminologie konnte die Anthropologie als eine eigenständige Wissenschaft etabliert werden.
Die Betonung von Wissenschaftlichkeit, Methodik und Terminologie resultierte in einer neuen Ausgabe der notes & queries (1912), zu welcher Rivers einen grundlegenden Beitrag lieferte. In dieser Ausgabe wurde auch ein professionelles methodisches Training für Leute, die anthropologische Forschung ausführen, gefordert.
Am Ende der 1. Dekade des 20. Jahrhunderts wurden in Großbritannien die ersten anthropologisch geschulten Ethnographen zur Durchführung intensiver Feldforschungen ausgesandt. Unter diesen Anthropologen befand sich auch Bronislaw Malinowski.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 1.3.1
1.4 Bronislaw Malinowski: Das klassische Modell der Feldforschung
Bronislaw Malinowski[1] beschreibt in seinem Werk „Argonauten des westlichen Pazifik“ (1922), ausgehend von seinen Feldforschungen auf den Trobriand Islands nord-westlich von Papua- Neuginea, den Kula- Handel[2], der verschiedene Inseln der Region verbindet. In der Einführung dieses Werkes stellt er methodische Überlegungen an, welche die Grundlage der ethnographischen Feldforschung im Sinne einer lang andauernden, teilnehmenden Beobachtung geworden sind.
"Bevor ich zu dem Bericht über das Kula komme, möchte ich die Methoden beschreiben, die bei der Sammlung des ethnographischen Materials verwendet wurden. In jedem Zweig der Wissenschaft sollten die Forschungsresultate redlich und absolut unvoreingenommen dargelegt werden.
Niemandem würde es einfallen, einen Experimentalbeitrag auf den Gebieten der Physik oder Chemie zu schreiben, ohne detailliert über alle Anordnungen der Versuche zu berichten: ohne eine exakte Beschreibung zu geben aller benutzten Apparate, der Art und Weise, in der die Beobachtungen zustande kamen; ihrer Anzahl; der Zeit, die auf sie verwendet wurde; und des Grads der Näherung an den exakten Wert bei jeder Messung.
In weniger exakten Wissenschaften wie der Biologie oder der Geologie läßt sich diese Genauigkeit nicht erreichen, aber dennoch wird sich jeder Wissenschaftler große Mühe geben, dem Leser alle Bedingungen, unter denen das Experiment oder die Beobachtungen zustande kamen, mitzuteilen. In der Ethnographie, für welche die unvoreingenommene Mitteilung solcher Daten vielleicht noch bedeutsamer ist, wurde dies in der Vergangenheit bedauerlicherweise nicht immer mit genügender Sorgfalt betrieben, und viele Autoren benutzen nicht den Scheinwerfer methodischer Redlichkeit, weil sie sich zwar mit ihren Ergebnissen auskennen, uns aber diese aus völliger Finsternis heraus vorlegen.
Mit Leichtigkeit ließen sich hoch geachtete, wissenschaftlich ausgewiesene Arbeiten anführen, in denen uns pauschale Verallgemeinerungen vorgelegt werden, aus denen wir aber nicht im geringsten erfahren, aufgrund welcher tatsächlichen Beobachtungen die Verfasser ihre Schlüsse gezogen haben. Kein besonderes Kapitel, kein Abschnitt ist dem Versuch gewidmet, die Bedingungen zu beschreiben, unter denen Beobachtungen gemacht und Informationen gesammelt wurden. Ich bin der Meinung, daß nur solche ethnographischen Quellen von zweifelsfreiem wissenschaftlichen Wert sind, in denen klar die Grenze gezogen werden kann zwischen den Ergebnissen direkter Beobachtung, Berichten und Interpretationen der Eingeborenen auf der einen Seite und den Schlußfolgerungen des Autors, die sich auf dessen gesunden Menschenverstand und sein psychologisches Einfühlungsvermögen stützen, auf der anderen Seite." (Malinowski 1979: 24f)
Malinowski betont hier die Wichtigkeit der ethnographischen Methode, die Notwendigkeit diese explizit zu machen und wendet sich gegen damals übliche spekulative und pauschale Verallgemeinerungen aus denen nicht nachvollziehbar ist, wie die Daten auf denen sie beruhen, erhoben wurden und zustande gekommen sind. Gleichzeitig führt er eine Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Arten von Daten ein: Beobachtungsdaten auf der einen Seite und lokale Interpretationen des Handelns und der Welt auf der anderen. Er betont die Notwendigkeit zwischen diesen Arten von Daten und den Schlussfolgerungen und Interpretationen des Autors, die auf Basis dieser Daten entwickelt werden, unterscheiden zu können.
Weiters beschäftigt er sich mit den Problemen des Feldeinstiegs und er entwickelt methodische Grundlagen der klassischen Feldforschung[3].
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-57.html
[2] http://www.lai.at/web/oeku/cp/theogrundlagen/theogrundlagen-110.html
[3] Siehe Kapitel 1.4.2.1
1.4.1 Probleme des Feldeinstiegs
In weiterer Folge geht Malinowski dazu über, seinen Feldeinstieg zu beschreiben und die Probleme zu benennen, die dabei auftauchen.
"Versetzen Sie sich in die Situation, allein an einem tropischen Strand, umgeben von allen Ausrüstungsgegenständen, nahe bei einem Eingeborenendorf abgesetzt zu sein, während die Barkasse oder das Beiboot, das Sie brachte, dem Blick entschwindet. Wenn Sie Ihre Wohnung in der Niederlassung eines benachbarten weißen Mannes genommen haben, eines Händlers oder Missionars, bleibt Ihnen nichts weiter zu tun, als unverzüglich mit Ihrer ethnographischen Arbeit zu beginnen. Stellen Sie sich des weiteren vor, daß Sie Anfänger sind ohne vorhergehende Erfahrung, ohne irgendeine Anleitung und jemanden, der Ihnen hilft; denn besagter Weißer ist zur Zeit abwesend oder sonst wie nicht in der Lage oder unwillig, seine Zeit an Sie zu vergeuden." (Malinowski 1979: 26)
Das Beginnen mit der ethnographischen Arbeit besteht bei Malinowski darin, Versuche zu unternehmen, eine Beziehung mit dem Feld aufzubauen. Das Ergebnis, das sich dabei einstellt, beschreibt er mit einem "Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung" und der Unmöglichkeit, in "eine wirkliche Berührung mit den Eingeborenen zu kommen oder mich mit irgendwelchem Material zu versorgen. Ich erlebte Perioden der Mutlosigkeit, während derer ich mich im Romanlesen vergrub, ähnlich einem Mann, der im Anfall tropischer Depression und Langeweile zu trinken beginnt." (Malinowski 1979: 26f)
Als zentrale Probleme beschreibt er, dass die Weißen vor Ort keine Hilfe für die Feldforschung darstellen, seine mangelnde Kenntnis der lokalen Sprache, die daraus resultierende Unmöglichkeit zu lokalen Interpretationen aus der Sicht der Eingeborenen zu kommen.
1.4.1.1 Feldforschung und die Rolle der nicht-indigenen Bevölkerung vor Ort
Malinowski charakterisiert die nicht-indigene Bevölkerung vor Ort als wenig hilfreich für die Forschung, denn diese werden "weder die Art verstehen, in der Sie als Ethnograph sich den Eingeborenen nähern müssen, noch (...) sich dafür interessieren." (Malinowski 1979: 26)
Darüber hinaus haben sie, obwohl sie Jahrelang in Interaktion mit den Eingeborenen leben, ein äußerst unvollkommenes Verständnis ihrer Kultur:
"Informationen, die ich von in der Gegend wohnenden Weißen erhielt, waren, so wertvoll sie für sich genommen sein mochten, in bezug auf meine Arbeit noch entmutigender als alles andere. Hier gab es Menschen, die jahrelang am Ort wohnten, denen es ständig möglich war, die Eingeborenen zu beobachten, sich mit ihnen zu unterhalten, und die dennoch kaum etwas von ihnen wirklich zuverlässig wußten. Wie konnte ich daher hoffen, sie in einigen Monaten oder in einem Jahr einzuholen, sie zu überholen? Zudem entsprach die Art und Weise, in der meine weißen Informanten über die Eingeborenen sprachen und ihre Meinungen äußerten, natürlich der von Laien; sie waren es nicht gewohnt, ihre Gedanken auch nur annähernd zusammenhängend und präzise zu äußern.
Zum größten Teil hegten sie, was nicht verwundern kann, einseitige und vorurteilsvolle Meinungen, die beim durchschnittlichen Mann der Praxis unvermeidlich sind, sei er Verwalter, Missionar oder Händler, und die dennoch auf den, der sich um eine objektive, wissenschaftliche Sicht der Dinge bemüht, stark abstoßend wirken müssen. Die Angewohnheit, mit selbstzufriedener Frivolität zu behandeln, was dem Ethnographen wirklich ernst ist, die Mißachtung dessen, was ihm ein wissenschaftlicher Schatz ist, d. h. der Kultur der Eingeborenen, ihrer charakteristischen geistigen Eigenarten und ihrer Unabhängigkeit, dies alles, uns wohl bekannt aus den unbedeutenden Amateurarbeiten, fand ich in der Geisteshaltung der Mehrheit der weißen Bewohner." (Malinowski 1979: 27f)
Malinowski leitet daraus die methodische Notwendigkeit[1] ab, sich im Zuge der Feldforschung "aus dem Kontakt mit den Weißen heraus zu lösen".
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 1.4.2
1.4.1.2 Feldforschung und mangelnde Sprachkenntnisse
Ein weiteres Problem der Feldforschung waren Malinowskis mangelnde Sprachkenntnisse:
"Zur gegebenen Zeit kam ich wieder und versammelte schon bald einen Zuhörerkreis um mich. Einige Komplimente in Pidgin-Englisch auf beiden Seiten, etwas Tabak, der von Hand zu Hand ging, schufen eine Atmosphäre gegenseitiger Freundlichkeit. Sodann versuchte ich, an die Arbeit zu gehen. Um auf einem Gebiet zu beginnen, das kein Mißtrauen erweckt, fing ich an, zuerst Technologie zu »lernen«. Einige Eingeborene wurden ermuntert, den einen oder anderen Gegenstand herzustellen. Es war einfach, dem zuzuschauen und sich die Namen einiger Werkzeuge anzueignen, ja sogar einige technische Ausdrücke für die Verrichtungen zu erhalten, aber damit war die Sache zu Ende. Man bedenke, daß das Pidgin-Englisch ein sehr unvollkommenes Instrument ist, um die eigenen Vorstellungen auszudrücken; zudem beschleicht einen, fehlt noch die Übung, Fragen zu formulieren und Antworten zu verstehen, das ungute Gefühl, daß die freie Kommunikation mit den Eingeborenen nie zu erreichen sein wird. Ich war nicht in der Lage, mit ihnen eine detailliertere oder explizitere Unterhaltung zu führen als die zu Beginn." (Malinowski 1979: 27)
Daraus leitet sich die Notwendigkeit ab, Feldforschung in der üblichen lokalen Sprache durchzuführen.
1.4.1.3 Konkrete Beobachtungen als totes Material: Das Fehlen lokaler Interpretationen
Angesichts der mangelnden Sprachkenntnisse beginnt Malinowski konkrete, das heißt objektiv beobachtbare Daten zu sammeln. Er stellt aber selbst fest, dass diese Daten ohne die lokalen Interpretationen "totes Material" bleiben würden.
"Mir war klar, daß hiergegen am besten das Sammeln konkreter Daten helfen würde, und ich nahm deshalb eine Zählung der Dorfbevölkerung vor, erstellte Stammbäume, zeichnete Pläne und stellte Verwandtschaftsbezeichnungen zusammen. Aber all dies blieb totes Material, welches das Verständnis für die Mentalität und das Verhalten der Eingeborenen nicht weiter vertiefte, da ich weder eine gute Interpretation dieser Punkte durch die Eingeborenen erhalten konnte, noch hinter das kam, was man Stammesleben nennen könnte. Beim Versuch, ihre Vorstellungen über Religion, Magie, ihren Glauben an Zauberei und Geister in Erfahrung zu bringen, ergaben sich lediglich einige oberflächliche Kenntnisse der Folklore, verstümmelt durch den Zwang, sie im Pidgin- Englisch auszudrücken." (Malinowski 1979: 27)
Methodisch leitet sich daraus die Notwendigkeit ab, nicht nur zu beobachten, sondern teilnehmende Beobachtung[1] zu betreiben und mit den Personen vor Ort zu interagieren und in ihren Alltag einzutauchen. Darüber hinaus ist es notwendig systematisch Erklärungen und Erzählungen zu dokumentieren[2], welche die lokalen Interpretationen in Bezug auf Religion, Magie etc. zum Ausdruck bringen.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 1.4.3.2
[2] Siehe Kapitel 1.4.3.3
1.4.2 Das Geheimnis der Feldforschung: methodische Grundlagen
Erst im Zuge der Feldforschung entdeckt Malinowski "das Geheimnis effektiver Arbeit im Feld" (Malinowski 1979: 28). Er fasst die methodischen Prinzipien in drei Bereichen zusammen:
- den wissenschaftlichen Zielen und Kriterien
- den Arbeitsbedingungen vor Ort
- und den Methoden des Sammelns, Aufbereitens und Sicherns der Daten[1]
"Zuerst muß der Forscher natürlich wirklich wissenschaftliche Ziele haben und die Kriterien und Wertmaßstäbe moderner Ethnographie kennen. Zweitens sollte er sich gute Arbeitsbedingungen schaffen, das heißt hauptsächlich, er sollte ohne andere Weiße direkt unter den Eingeborenen leben. Schließlich muß er eine Reihe besonderer Methoden des Sammelns, Aufbereitens und Sicherns seines Belegmaterials anwenden." (Malinowski 1979: 28)
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 1.4.3
1.4.2.1 Feldforschung als dauerhafte In-Beziehungsetzung zum Feld
Daraus leitet er dann methodische Grundlagen für optimale Arbeitsbedingungen vor Ort ab. Als wichtigstes Prinzip nennt er:
"daß man sich aus dem Umgang mit anderen Weißen herauslöst und in möglichst engem Kontakt mit den Eingeborenen bleibt. Dies ist nur dann wirklich zu erreichen, wenn man direkt in ihren Dörfern zeltet (Abb. 1 und 2). Es ist sehr schön, auf dem Grundstück eines Weißen einen Versorgungsstützpunkt für die Vorräte zu besitzen und zu wissen, daß es ein Refugium gibt für Zeiten der Krankheit und des Überdrusses an den Eingeborenen. Es muß jedoch weit genug entfernt liegen, damit sich kein ständiges Milieu entwickeln kann, in dem man lebt und aus dem man nur zu bestimmten Stunden auftaucht, »um sich mit dem Dorf zu beschäftigen«.
Es sollte nicht einmal so nahe liegen, daß man es jederzeit zur Erholung aufsuchen könnte. Da der Eingeborene nicht der natürliche Gesellschafter eines weißen Mannes ist, sehnt man sich selbstverständlich, nach dem man mehrere Stunden mit ihm gearbeitet hat, ihm bei der Gartenarbeit zusah oder sich von ihm Einzelheiten der Folklore erzählen ließ oder seine Bräuche besprach, nach Umgang mit der eigenen Art. Wenn man sichaber in einem weitab gelegenen Dorf alleine aufhält, macht man eben einen einsamen Spaziergang von vielleicht einer Stunde und sucht dann bei der Rückkehr ganz selbstverständlich die Gesellschaft des Eingeborenen, diesmal aber als Linderung der Einsamkeit, so wie man jede andere Gemeinschaft wünschte." (Malinowski 1979: 28f)
1.4.2.1.1 Die Konstruktion des Feldes
Malinowski betont die Notwendigkeit seinen Feldforschungsort weitab von westlichen Einflüssen und der Zivilisation zu positionieren um "wirklich" in die indigene Welt eintauchen zu können. Hier wird implizit eine bestimmte Form – wie man heute sagen würde – der „Konstruktion des Feldes“ vorgenommen. Es macht darauf aufmerksam, dass das zu untersuchende Feld nicht einfach gegeben ist. Vielmehr beruht es auf strategischen Entscheidungen, abhängig vom Forschungsinteressen, wo man die Grenzen des zu untersuchenden Feldes setzt. Das heißt, man muss entscheiden, welche Orte, Phänomene und Kontakte man in die eigene Untersuchung mit einschließt und welche man ausspart. Dies verweist oft auch auf implizite und oft unbewusste Annahmen des Forschers, welche Phänomene „relevant und authentisch“ sind.
Das Paradigma welches Malinowski hier mit seinen methodischen Anweisungen etabliert, ist die Untersuchung möglichst traditioneller und von westlichen Einflüssen unberührter indigener Lebenswelten. Diese waren lange Zeit Standard klassischer Ethnographien nicht nur im britischen Funktionalismus. Diese produzierten eine eigene Selektivität der Darstellung, da in vielen Ethnographien all jene Aspekte, die nicht diesem Ideal der schwer erreichbaren und von der Zivilisation unberührten "Wilden" entsprachen ausgeklammert und ignoriert wurden. Dies wurde zum Gegenstand berechtigter Kritik und führte z.B. zur Entwicklung der Extended Case Method[1]. Kulturen werden heute nicht mehr als abgeschlossene Einheiten konzipiert. Vor dem Hintergrund von translokalen Vernetzungen und Einflüssen im Zuge der Globalisierung wurde insbesondere das Verhältnis von Lokalem und Globalem zum Gegenstand ethnographischer Forschung und führte unter anderem zur Entwicklung der multi-sited ethnography[2].
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 5.1
[2] Siehe Kapitel 5.5
1.4.2.2 Lernen vom Feld
Durch die teilnehmende Auseinandersetzung mit dem Feld erschließen sich dem Feldforscher auch die lokalen Normen, die Regeln und moralischen Prinzipien des Zusammenlebens.
"Ich verletzte auch immer wieder die guten Sitten, worauf mich die Eingeborenen, die mit mir vertraut waren, schnell hinwiesen. Ich mußte lernen, wie ich mich zu verhalten hatte, und erwarb mir bis zu einem gewissen Grad ein »Gefühl« für die guten und schlechten Sitten der Eingeborenen." (Malinowski 1979: 30)
1.4.2.3 Aktive Methoden
"Aber der Ethnograph muß nicht nur sein Netz am rechten Ort auswerfen und auf das warten, was sich darin fängt. Er muß aktiver Jäger sein, das Wild in sein Netz hineintreiben und ihm in seine unzugänglichen Verstecke folgen. Dies führt uns zu den aktiveren Methoden, ethnographische Zeugnisse zu erlangen." (Malinowski 1979: 30)
Feldforschung beschränkt sich nicht nur auf passive teilnehmende Beobachtung im Sinne eines "deep hanging round". Es kommen vielmehr, im Sinne einer Methodentriangulation[1], unterschiedliche methodische Verfahren, wie z.B. Interviews und gezielte Befragungen zum Einsatz. Ethnographie beruht somit auf dem flexiblen Einsatz verschiedener methodischer Strategien.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-50.html
1.4.2.4 Induktion - Deduktion
Malinowski betont die Notwendigkeit einer theoretisch informierten und reflektierten Vorgangsweise, die aber Grundlage einer offenen und induktiven Strategie der Theoriegenerierung sein sollte. Deduktive Strategien, die darauf abzielen, vorgefasste Theorien zu beweisen, lehnt er als schädlich für die wissenschaftliche Erkenntnis ab.
"Verfügt man über eine gute theoretische Ausbildung und die Kenntnis der neuesten Resultate, so bedeutet das nicht, daß man sich mit »vorgefaßten Ideen« belasten würde. Wenn jemand eine Expedition durchführt und dabei entschlossen ist, seine Hypothesen zu beweisen, wenn er unfähig ist, beständig seine Ansichten zu ändern und sie großzügig fallen zu lassen unter dem Druck der Zeugnisse und Belege, dann ist seine Arbeit offenkundig wertlos. Aber je mehr Probleme er mit sich ins Feld nimmt, je mehr er sich bemüht, seine Theorien den Fakten entsprechend umzuformen und die Fakten in ihrer Auswirkung auf die Theorie zu sehen, desto besser ist er auf seine Arbeit vorbereitet. Vorgefaßte Ideen sind in jedem wissenschaftlichen Werk schädlich, während ein Gespür dafür, wo Probleme liegen, zur Grundausrüstung eines wissenschaftlichen Denkers gehört, und diese Probleme zeigen sich dem Beobachter zuerst durch seine theoretischen Studien" (Malinowski 1979: 31)
1.4.2.5 Trennung von Empirie und Theorie
Malinowski geht von einer strikten Trennung der objektiven Dokumentation empirischer Daten auf der einen Seite und deren theoretischer Verallgemeinerung auf der anderen aus. Er betont die Notwendigkeit, die empirischen Daten von den theoretischen Schlüssen sichtbar und nachvollziehbar zu trennen. Dies kommt auch im Zuge des Forschungsablaufs zum Ausdruck, der auf einer Trennung von Datenerhebung und analytischer Theorieentwicklung beruht.
"Der empirisch Forschende stützt sich völlig auf die Anregungen der Theorie. Natürlich kann auch er ein Theoretiker sein und aus sich selbst Anregungen empfangen. Dennoch sind diese beiden Funktionen voneinander getrennt und müssen während der eigentlichen Forschungsarbeit zeitlich und in bezug auf die Arbeitsbedingungen getrennt werden." (Malinowski 1979: 31)
Hier kommt einerseits ein positivistisches Verständnis[1] objektiver Daten und der Datenerhebung zum Ausdruck, andererseits auch eine lineare Konzeption des Forschungsablaufs, die im Gegensatz zu zirkulär iterativen Forschungsabläufen[2] steht, welche Datenerhebung und -analyse systematisch miteinander verbinden.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 2.2
[2] Siehe Kapitel 4.2
1.4.2.6 Die Suche nach Ordnung und Gesetzen
Das primäre Ziel der Feldforschung ist, nach Malinowski, allgemeine Gesetz- und Regelmäßigkeiten des sozialen Zusammenlebens und der kulturellen Phänomene zu identifizieren. Auch hier kommt eine positivistische Grundorientierung[1] zum Ausdruck, deren primäres Erkenntnisinteresse auf Erklärungen in Form allgemeiner Gesetzmäßigkeiten abstellt.
"Wie es immer geschieht, wenn wissenschaftliches Interesse sich einem Feld zuwendet, das bisher nur von der Neugierde der Amateure durchforscht wurde, und dort zu arbeiten beginnt, hat auch die Ethnologie Gesetz und Ordnung ins scheinbar Chaotische und Unberechenbare eingeführt. Sie hat uns die aufsehenerregende, ungezähmte, unerklärliche Welt der »Wilden« in eine Anzahl gut geordneter Gemeinschaften verwandelt, die von Gesetzen, Verhaltensweisen und einem Denken beherrscht werden, die alle zusammenhängenden Prinzipien folgen (...).
Von der berühmten Antwort eines repräsentativen Fachmanns auf die Frage, was Sitten und Gebräuche der Eingeborenen seien: »Sitten keine, Gebräuche tierisch« führt ein langer Weg bis zur Position des modernen Ethnographen! Letzterer belegt mit seinen Tabellen der Verwandtschaftsbezeichnungen, Genealogien, Landkarten, Plänen und Diagrammen die Existenz einer ausgedehnten und großen Organisation; er zeigt den Aufbau des Stammes, des Clans und der Familie und entwirft uns ein Bild der Eingeborenen, wie sie einem strikten Verhaltens- und Sittenkodex unterworfen sind, demgegenüber das Leben am Hofe von Versailles oder Escorial frei und leicht gewesen sein muß.
Daher ist es das erste und grundlegende Ideal der ethnographischen Arbeit im Feld, den sozialen Aufbau klar und fest zu umreißen und die Gesetze und Regelmäßigkeiten aller kulturellen Phänomene aus dem Irrelevanten auszusondern. Das starre Skelett des Stammeslebens muß zuerst ermittelt werden." (Malinowski 1979: 32f; eigene Hervorhebungen)
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 2.2
1.4.3 Drei zentrale methodische Verfahren
Zu den Methoden des Sammelns von Daten zählt Malinowski drei konkrete Verfahren:
- die statistische Dokumentation
- die Beschreibung der Imponderabilien des wirklichen Lebens auf Basis Teilnehmender Beobachtung
- die Sammlung charakteristischer Erzählungen und typischer Äußerungen (Corpus Inscriptionum) als Dokument der Mentalität des Eingeborenen
"Neben dem festen Umriß des Stammesaufbaus und den sich herauskristallisierenden Einzelheiten der Kultur, die das Skelett bilden, neben den Daten des Alltagslebens und dem normalen Verhalten, die sozusagen sein Fleisch und Blut ausmachen, muß noch der Geist aufgezeichnet werden - die Anschauungen, Meinungen und Äußerungen des Eingeborenen." (Malinowski 1979: 46)
Als Endziel der ethnographischen Forschung sieht Malinowski die Darstellung des Standpunktes der Eingeborenen, ihren Bezug zum Leben zu verstehen und sich ihre Sicht der Welt vor Augen zu führen.
1.4.3.1 Das Skelett: die Dokumentation objektiver Daten
Malinowski geht davon aus, dass "das starre Skelett des Stammeslebens (...) zuerst ermittelt werden (muss). Dieses Ideal bringt an erster Stelle die Verpflichtung mit sich, eine vollständige Übersicht über die Phänomene zu geben und nicht das Sensationelle und Einzigartige, schon gar nicht das Lustige und Wunderliche herauszulesen." (Malinowski 1979: 33)
Es geht hierbei um eine systematische und umfassende Dokumentation einzelner Fälle (cases, siehe auch Extended Case Method[1]), die dazu dienen, Ordnungsprinzipien, Regeln und Regelmäßigkeiten die diesen Fällen zugrunde liegen, zu identifizieren. Es geht also um das Sammeln von konkreten Belegmaterialien aus dem generalisierende Schlüsse gezogen werden können.
Diese Materialien sollten in Form objektiver, tabellarischer und umfassender Zusammenfassungen konkreter Erscheinungen veranschaulichen. Malinowski nennt dies auch die „Methode statistischer Dokumentation durch konkrete Zeugnisse“ (Malinowski 1979: 41). Es ist dieser feste Umriss des Stammesaufbaus und die sich herauskristallisierenden Einzelheiten der Kultur, die das Skelett (der Untersuchung) bilden (Malinowski 1979: 46).
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 5.1
1.4.3.2 Das Fleisch: Teilnahme und Deskription des sozialen Lebens
Dem "vorzüglichen Skelett der Stammesorganisation", welches in Form der Dokumentation objektiver Daten vorliegt, fehlt allerdings "Fleisch und Blut", da diese Daten noch nicht die Wirklichkeit des menschlichen Lebens veranschaulichen. Malinowski stellt auch fest, dass die Regeln und Ordnungen, die es zu erkennen gilt, in ihrer "Exaktheit dem wirklichen Leben fremd (sind), das niemals starr irgendwelche Regeln befolgt". (Malinowski 1979: 41) Diese Regeln müssen durch teilnehmende Beobachtung ergänzt werden, welche veranschaulicht, wie etwas durchgeführt wird aber auch ermöglicht, immer auftretende Ausnahmen darzustellen.
Dabei handelt es sich um Phänomene, die nicht immer durch Befragung oder Dokumentenanalyse in Erfahrung zu bringen sind, sondern "in ihrer vollen Wirklichkeit beobachtet werden müssen". (Malinowski 1979: 42f) Diese nennt Malinowski die Imponderabilien des wirklichen Lebens und typischen Verhaltens, welche dokumentiert und aufgezeichnet werden müssen. Dabei ist es notwendig "daß dies nicht in Form der Registrierung oberflächlicher Einzelheiten geschieht, wie ungeübte Beobachter dies gewöhnlich anstellen, sondern in dem Bemühen, in die Geisteshaltung einzudringen, die in ihnen ihren Ausdruck findet." (Malinowski 1979: 43)
Malinowski betont die Notwendigkeit, dauerhaft und für lange Zeit in das zu untersuchende Feld einzutauchen und in diesem natürlichen Umfeld zu leben, ohne es zu verlassen. Dieses dauerhafte in Beziehung setzen mit dem Feld erlaubt das alltägliche Leben der Untersuchten in all seinen Aspekten direkt zu beobachten und macht den Feldforscher im Laufe der Zeit zu einem Teil des Feldes. Dies hat den Vorteil, dass er dort nicht mehr als fremd wahrgenommen wird und der Forscher „nicht länger ein Störfaktor im Stammesleben“ ist (Malinowski 1979: 29). Das heißt, im Gegensatz zu anderen Methoden zeichnet sich die Feldforschung dadurch aus, dass man nach Möglichkeit versucht soziales Verhalten und kulturelle Phänomene im natürlichen Umfeld direkt zu beobachten ohne künstliche Situationen zu kreieren, wie dies etwa bei Interviews oder Experimenten der Fall ist. Man etabliert eine alltägliche Beziehungsebene zu den Beforschten und nimmt an deren Leben teil.
Ziel ist es, diese Beobachtungen festzuhalten, wobei man die Tatsachen für sich selbst sprechen lassen sollte und diese in Form eines ethnographischen Tagebuches, während des ganzen Verlaufs der Feldforschung dokumentieren sollte. Dabei sollten z.B. bei der Beobachtung von Zeremonien oder Stammesereignissen, nicht nur Vorkommnisse und Einzelheiten dokumentiert werden, die nach Tradition und Brauch den wesentlichen Ablauf der Handlung bilden, sondern auch die Handlungen der Akteure und Zuschauer sorgfältig und präzise festgehalten werden.
1.4.3.3 Der Geist: die Sammlung charakteristischer Erzählungen
Neben dem Skelett in Form objektiver Daten und dem Fleisch, der Beobachtung konkreten Verhaltens, sollte auch noch der Geist, d.h. "die Anschauungen, Meinungen und Äußerungen der Eingeborenen" (Malinowski 1979: 46) festgehalten werden. Malinowski geht es dabei um die stereotypen, das heißt kollektiven Formen des Denkens und Fühlens und nicht um die individuellen Emotionen. Seiner Auffassung nach steht "die Prägung des Geisteszustandes durch die gesellschaftlichen Institutionen" im Zentrum des Interesses.
„So kann ein Mann, der in einer polyandrischen Gesellschaft, lebt, nicht dieselben Gefühle der Eifersucht empfinden, wie ein strenger Monogynist, obwohl er über die Grundlage zu diesen Gefühlen vielleicht verfügt.“ (Malinowski 1979: 47)
„Das dritte Gebot der Feldarbeit lautet also: Ermittle die typischen Formen des Denkens und Fühlens, die den Institutionen und der Kultur einer bestimmten Gemeinschaft zugehören und formulieren die Ergebnisse in der überzeugendsten Weise.“ (Malinowski 1979: 47)
Um die Anschauungen, Meinungen und Äußerungen der Untersuchten überzeugend zu dokumentieren, ist es notwendig, deren Aussagen wortwörtlich zu zitieren sowie Begriffe aus der Klassifikation der Eingeborenen zu verwenden. Hier stellen sich wieder die Notwendigkeit der Sprachkenntnisse und Probleme der Übersetzung. Malinowski bezeichnet dieses linguistische Material auch als Corpus Inscriptionum, welcher die Grundlage für unterschiedliche Interpretationen ist.
1.5 Literatur
Barth, Frederik; Gingrich, Andre; Parkin, Robert; Silverman, Sydel (2005): One Discipline Four Ways: British, German, French, and American Anthropology. University Of Chicago Press, Chicago.
Duchkowitsch, Wolfgang (1989): Zeitungswissenschaft "an der schönen heimatlichen Donaustadt". Aufbau, Errichtung und Funktion des Wiener Instituts für Zeitungswissenschaft. In: Heisz, Gernot; Mattl, Siegfried; Meissl, Sebastian et al. (Hrsg.): Willfährige Wissenschaft. Die Universität Wien 1938 - 1945. Verlag für Gesellschaftskritik, Wien: S. 155-178.
Müller, Klaus (1997): Geschichte der antiken Ethnologie. Rowohlt: Reinbek bei Hamburg.
Urry, James (1984): A history of field methods. In: Ellen, R.F. (Hg.) Ethnographic Research. A Guide to General Conduct. Academic Press: London [u.a.]:. S. 35-61.
2 Einige wissenschaftstheoretische Grundlagen der empirischen Sozialforschung
Im Vorfeld der Umsetzung konkreter Forschungsprojekte stellen sich erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Probleme, die sich in der Grundfrage zusammenfassen lassen: "Wie ist Erkenntnis möglich?" Aus dieser scheinbar einfachen Frage leiten sich einerseits philosophische, andererseits methodologische Fragen ab:
Zu den philosophischen Problemen gehört die Frage "Was kann man über die Welt wissen?". Diese Frage impliziert einerseits Annahmen über die Beschaffenheit der Realität, d.h. Annahmen über die Grundstrukturen des Seienden, welche unter dem Begriff der Ontologie zusammengefasst werden. Neben den Annahmen über die Beschaffenheit der Realität, impliziert die Frage, was man über die Welt wissen kann, aber auch ein epistemologisches, d.h. erkenntnistheoretisches Problem. Dieses kommt in der Frage zum Ausdruck, welche Erkenntnisse bei welcher Beweisführung als sicher bzw. als wahr gelten. Dieses philosophische Problem bezieht sich also auf zwei Grundfragen:
1) Was ist Wirklichkeit?
2) Was ist Wahrheit?
Ausgehend von diesen philosophischen Grundfragestellungen stellt sich die Frage der Methodik "Wie kann man das Wissen über die Welt in Erfahrung bringen bzw. erfassen?". Diese Frage wurde im Zuge der Entwicklung der Sozial- und Kulturwissenschaften auf sehr unterschiedliche Art und Weise beantwortet und kommt in unterschiedlichen Positionen, wie z.B. dem Positivismus[1], dem Neo-Positivismus[2], dem kritischen Rationalismus[3], dem Pragmatismus[4] oder der Hermeneutik[5] zum Ausdruck. Diese Positionen implizieren spezifische Auffassungen über die Wirklichkeit, wie wahre Aussagen über die Wirklichkeit gemacht werden können und legen wissenschaftliche Vorgehensweisen im Sinne einer Methodik nahe.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 2.2
[2] Siehe Kapitel 2.2.1
[3] Siehe Kapitel 2.2.1
[4] Siehe Kapitel 2.3.2
[5] Siehe Kapitel 2.3.1
2.1 Methoden, Methodik und Methodologie
Im Deutschen können drei eng verwandte Begrifflichkeiten unterschieden werden, nämlich Methoden, Methodik und Methodologie.
Auf der allgemeinsten Ebene kann man unter Methodik die Gesamtheit der Techniken der wissenschaftlichen Vorgehensweisen bezeichnen. In diesem Sinne kann man etwa von einer Methodik des Evolutionismus, des Diffusionismus, des Funktionalismus[1] oder Strukturalismus sprechen.
Im Gegensatz dazu kann man auf einer konkreteren Ebene von Methoden in zweifacher Hinsicht sprechen. Einerseits von Methoden der Datenerhebung (Befragung, Beobachtung etc.), andererseits von Methoden der Datenanalyse (Inhaltsanalyse, Diskursanalyse etc.). Innerhalb der Kultur- und Sozialanthropologie wird oft nicht hinreichend zwischen Methodik und den konkreten Methoden unterschieden und z.B. von der Methode der Konstruktion menschlicher Entwicklungslinien im Evolutionismus oder von Kulturkontakten im Diffusionismus gesprochen.
Im Gegensatz zu Methodik und Methode bezeichnet der Begriff der Methodologie die Theorie bzw. Lehre von den wissenschaftlichen Methoden, d.h. zur Methodologie gehören Aussagen und Kriterien,
- welche Methode für bestimmte Anwendungen geeignet ist
- wieso eine bestimmte Methode angewendet wird und keine andere
- warum für bestimmte Probleme eine bestimmte Methode angewandt werden sollte
Oft wird der Begriff der Methodologie auch unpräzise für Methodik verwendet, wie etwa in der Aussage "Diese Untersuchung bedient sich folgender Methodologie."
Erschwerend kommt hinzu, dass die begriffliche Unterscheidung zwischen Methodik und Methodologie in anderen Sprachen, wie z.B. dem Englischen nicht existiert. Der englische Begriff der methodology umfasst Methodik und Methodologie.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-60.html
2.2 Der Positivismus
Der Positivismus ist ein Kind der Aufklärung und wendet sich gegen irrationale bzw. religiöse Erklärungen. Er lehnt jegliche Metaphysik als theoretisch unmöglich und praktisch nutzlos ab. Die Forschung hat sich auf das Positive, d.h. das Tatsächliche, Wirkliche und Zweifellose zu beschränken und sich allein auf konkrete Erfahrungen zu berufen.
Der Positivismus geht auf Auguste Comte zurück (1798- 1857), der argumentierte, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nur auf Tatsachen, d.h auf wirklich Gegebenem, das objektiv erkannt werden kann, zu beruhen haben. Ziel der Wissenschaft, sowohl der Naturwissenschaft, wie der Sozial- bzw. Geisteswissenschaft. ist aus dieser Perspektive die Erkenntnis und Formulierung von allgemeinen Theorien und Gesetzmäßigkeiten. Der Positivismus war die Leitidee, das zentrale Paradigma des 19. Jahrhunderts. Als wissenschaftlich galt nur, was beobachtbar und durch wissenschaftliche Experimente konkret erfassbar ist.
Die vier zentralen Grundannahmen sind:
1) Es existiert eine einzige Art von Wirklichkeit.
2) Die einzige Erkenntnisquelle ist die sinnliche Erfahrung.
3) Das Postulat von der Einheit der Wissenschaft.
4) Die Ablehnung aller nicht-deskriptiven, d.h. metaphysischen Aussagen.
Innerhalb der Kultur- und Sozialanthropologie ist eine positivistische Grundüberzeugung und der damit in Verbindung stehende Methodenmonismus Grundlage der so genannten "Scientists", im Gegensatz zu den "Humanists". Ansätze wie der Evolutionismus, der (Kultur-)Materialismus und die Kulturökologie, beruhen auf positivistischen Grundaxiomen.
Der bekannteste Kulturmaterialist innerhalb der Kultur- und Sozialanthropologie, Marvin Harris, geht von einem radikalen ökologischen, technologischen und demographischen Determinismus von Kultur aus. Er hat in Bezug auf die Arbeit des Linguisten Kenneth Pike auch die Unterscheidung von „etisch“ und „emisch“[1] in der Anthropologie verbreitet.
Aber auch Positionen, die von einem sozialen Determinismus (z.B. Durkheim) ausgingen sowie der Funktionalismus [2](Malinowski) und Strukturfunktionalismus (Radcliffe-Brown) haben die Formulierung und Entwicklung von Gesetzmäßigkeiten zum Ziel.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 2.4
[2] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-57.html
2.2.1 Neopositivismus und kritischer Rationalismus
Eine Weiterentwicklung des klassischen Positivismus ist der Neopositivismus, der auch als logischer Empirismus[1] bezeichnet wird. Dieser wurde insbesondere vom so genannten Wiener Kreis (Rudolf Carnap, Otto Neurath, Kurt Gödel, Moritz Schlick, u.a.) geprägt.
Der Neopositivismus fügt den Grundannahmen des klassischen Positivismus die mathematische Logik als Ordnungsprinzip und Instrument der Analyse, sowie - in Anlehnung an Ludwig Wittgenstein - die Sprachkritik, hinzu. Der logische Empirismus basierte u.a. auf dem so genannten Sinnkriterium, welches nur solche Aussagen als sinnvoll akzeptierte, die sich empirisch verifizieren lassen. Empirisch nicht verifizierbare Aussagen, z.B. über Gott, Engel oder Geister, waren demnach empirisch sinnlos, metaphysisch und nicht wissenschaftlich.
Der gebürtige Österreicher Sir Karl Popper (1902- 1994) hat den Kritischen Rationalismus begründet und insbesondere das Theorem der Verifikation von Aussagen kritisiert. Sein Hauptwerk ist die "Logik der Forschung" (1935). Als zentrales Prinzip der kritisch-rationalen Forschungsmethodologie gilt, dass "alle Aussagen einer empirischen Wissenschaft" - sofern sie unzutreffend sind - "prinzipiell an der Erfahrung scheitern können" (Popper 1971: 15). Das heißt, empirische wissenschaftliche Aussagen müssen, im Gegensatz zum Sinnkriterium, falsifizierbar sein, also durch neue empirische Erkenntnisse widerlegt werden können.
So ist der Satz "Morgen wird es regnen oder nicht regnen." zwar sicher wahr aber nicht falsifizierbar und deshalb wissenschaftlich unbrauchbar. Der Erkenntnistheorie Poppers zufolge muss jede Aussage bzw. jede Theorie die Bedingungen ihrer eigenen Falsifikation, d.h. Widerlegung beinhalten. Wissenschaft ist somit ein fortschreitender Prozess der Annäherung an die Wahrheit und Aussagen gelten so lange als wahr, solange sie nicht empirisch falsifiziert sind. In diesem Sinne ist Popper ein Vertreter der so genannten "Korrespondenztheorie der Wahrheit", welche davon ausgeht, dass eine Aussage dann wahr ist, wenn sie mit dem Sachverhalt, den sie beschreiben will, korrespondiert, d.h. übereinstimmt.
Eine andere Auffassung von Wahrheit kommt in der "Konsenstheorie" zum Ausdruck, die davon ausgeht, dass wahr sei, worüber in einem freien, offenen Diskurs ein Konsens gefunden werden kann. Einer der wichtigsten Vertreter dieser Auffassung ist der deutsche Sozialphilosoph und Vertreter der Kritischen Theorie Jürgen Habermas. Diese und andere Auffassungsunterschiede zwischen Vertretern des kritischen Rationalismus (Karl Popper, Hans Albert) und der kritischer Theorie (Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas) wurden im so genannten Positivismusstreit in den 1960er Jahren ausgetragen.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 2.5
2.2.2 Thomas Samuel Kuhn und die wissenschaftlichen Revolutionen
Thomas Samuel Kuhn war ein US-amerikanischer Physiker und Wissenschaftstheoretiker, der ebenfalls vielfach dem kritischen Rationalismus zugerechnet wird. Im Gegensatz zu Karl Popper gibt es bei ihm allerdings keine strikte Verbindung zwischen den wissenschaftlichen Theorien und einer vom Subjekt unabhängigen Realität. Kuhn wandte sich in seinem Werk "Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen" gegen die übliche Vorstellung, dass Wissenschaft eine kontinuierliche Wissensanhäufung auf Basis genauerer Daten und umfangreicherer Theorien sei. Ihm zu folge ist Wissenschaft nicht nur ein stetiges Anwachsen von Erkenntnissen, sondern durch unterschiedliche Phasen und Brüche gekennzeichnet, die er als "wissenschaftliche Revolutionen" bezeichnet. In diesen Phasen kommt es zu einem Paradigmenwandel, wobei mit Paradigma das begrifflich-methodische System einer Wissenschaft gemeint ist, welches gleichzeitig den Rahmen setzt innerhalb dessen Probleme definiert und Problemlösungen gesucht werden. Als ein klassisches Beispiel für eine Paradigmenwandel gilt in der Physik der Übergang von der Newtonschen Physik zu der Relativitätstheorie Einsteins.
Kuhn geht weiters davon aus, dass eine Inkommensurabilität, d.h. eine Unverträglichkeit, zwischen den einzelnen Paradigmen besteht.
Innerhalb der Sozial- und Geisteswissenschaften kommt es allerdings selten zur vollständigen Ablösung eines alten Paradigmas durch ein neues, vielmehr bestehen gleichzeitig unterschiedliche Erklärungsansätze bzw. Paradigmen nebeneinander.
2.3 Nicht-positivistische wissenschaftstheoretische Ansätze in den Geistes- und Sozialwissenschaften
Nicht-positivistische wissenschaftstheoretische Ansätze in den Geistes- und Sozialwissenschaften speisen sich aus unterschiedlichen philosophischen Überlegungen und Traditionen. Dazu zählen Wilhelm Dilthey’s lebensphilosophische Überlegungen zur Konzeption der Geisteswissenschaften als eigenen Zuständigkeitsbereich und deren historisch hermeneutische methodische Ausrichtung in Abgrenzung zu den Naturwissenschaften. Im Gegensatz zu nomothetisch ausgerichteten erklärenden Naturwissenschaft konzipiert er die Geisteswissenschaften als idiographisch beschreibend und verstehend.
Innerhalb der US-amerikanischen Philosophie entwickelte der Pragmatismus ein nicht-positivistisches Realitätsverständnis.
Während innerhalb der deutschsprachigen Wissenschaftslandschaft Edmund Husserl eine phänomenologische Erkenntnistheorie begründete.
Während der Positivismus aber auch der Kritische Rationalismus die Existenz einer realen Welt unterstellt, welche unabhängig vom erkennenden Subjekt besteht, geht der Pragmatismus, aber auch andere Ansätze wie z.B. die Phänomenologie von einem multiplen Realitätsverständnis aus. Die erfahrbare Welt stellt sich abhängig vom Kontext und vom Beobachter dar. Im Unterschied zum methodischen Monismus des Positivismus geht der methodische Dualismus davon aus, dass mehrere unterschiedliche Realitäten bzw. Interpretationsweisen der Welt existieren.
Innerhalb der Kultur- und Sozialanthropologie führten diese wissenschaftstheoretischen Ansätze zu einem Fokus auf Verstehen (Max Weber für die Soziologie) und Bedeutung im Sinne der symbolischen und interpretativen Anthropologie (Clifford Geertz) aber auch der Ethnoscience (Brent Berlin) und der postmodernen Ansätze. Die Vertreter dieser Ansätze, in all ihrer Verschiedenheit, werden oft als Humanists im Gegensatz zu den Scientists bezeichnet, oder aber auch aufgrund ihres Fokus auf Verstehen und Bedeutung, als Mentalisten.
Im Gegensatz zur Entwicklung allgemeiner Gesetzmäßigkeiten stellen Vertreter dieser Grundorientierung eher partikuläre Detailuntersuchungen an, mit dem Ziel, wie es bereits Malinowski formulierte „to grasp the native´s point of view, his relation to life, to realise his vision of his world” (Malinowski 1922: 25). Eine zentrale Schwierigkeit dabei besteht darin, dass wissenschaftlich keine völlig emische Darstellung[1] des "native points of view" möglich ist, denn eine solche Darstellung beruht immer auf notwendiger Weise unvollständiger und selektiver Übersetzung. Ethnographien beruhen somit auf Beobachtungen zweiter oder höherer Ordnung (Beobachtungen von Beobachtungen) bzw. wie Clifford Geertz[2] formuliert, auf Interpretationen von Interpretationen.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 2.4
[2] Siehe Kapitel 5.3
2.3.1 Die Hermeneutik
Die Hermeneutik ist die "Kunst" des Verstehens und Deutens von Texten, Verhaltensweisen und Kulturmustern. Sie ist nach dem griechischen Gott Hermes benannt, der das Verstehen zwischen Göttern und Menschen und damit auch zwischen Menschen und Menschen gefördert hat.
Im Gegensatz zum Positivismus, der von einer äußerlichen Realität ausgeht, die objektiv beschreibbar ist, existiert aus der Sicht der Hermeneutik keine objektive Realität, sondern nur verschiedene Interpretationen bzw. Auslegungen von Phänomenen, Texten und Handlungen.
Zu den zentralen philosophischen Grundlagen der Hermeneutik gehören die Arbeiten von Autoren, wie Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger und Hans-Georg Gadamer. Aber auch Jürgen Habermas als Vertreter der kritischen Theorie baut in seiner Theorie des kommunikativen Handelns auf Strategien der Texthermeneutik. Er setzt neben dem Sinnverstehen jedoch insbesondere auf die Sinnkritik.
Innerhalb der Kultur- und Sozialanthropologie haben hermeneutische und interpretative Verfahren vor allem durch Clifford Geertz eine weit über die Grenzen der Disziplin hinausgehende Popularität erfahren. In der deutschsprachigen Soziologie wurden hermeneutische Interpretationsverfahren insbesondere im Rahmen der so genannten "objektiven Hermeneutik" weiter entwickelt und systematisiert.
Da aus der Sicht der Hermeneutik keine objektive Realität existiert, kann ihr Wahrheitskriterium nicht in einer Korrespondenz von wissenschaftlichen Aussagen und externer Realität begründet liegen. Im Sinne der unterschiedlichen Auslegungs- und Interpretationsmöglichkeiten geht es nicht um eine objektive Wahrheit, sondern um eine Horizonterweiterung durch diese Auslegungen. Clifford Geertz spricht in diesem Sinn von einer Erweiterung des menschlichen Diskursuniversums als Ziel der interpretativen Anthropologie. An diese Auffassung von Wahrheit schließt auch die "Konsenstheorie" an, die davon ausgeht, dass wahr sei, worüber in einem freien, offenen Diskurs ein Konsens gefunden werden kann. Einer der wichtigsten Vertreter dieser Auffassung ist der deutsche Sozialphilosoph und Vertreter der Kritischen Theorie Jürgen Habermas.
Weiterführende Literatur:
Hermeneutik I[1]
Hermeneutik II[2]
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://buecherei.philo.at/herm.htm
[2] http://evakreisky.at/onlinetexte/nachlese_hermeneutik.php
2.3.2 Der Pragmatismus
Der Pragmatismus entstand im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts als zentrale Strömung der US-amerikanischen Philosophie und war in weiterer Folge auch prägend für die Theorie- u. Methodenentwicklung insbesondere auch der so genannten Chicagoer Soziologie (Street Corner Society). Zu den zentralen Vertretern gehören Charles S. Peirce, William James, John Dewey, George Herbert Mead.
Der Pragmatismus ist Ausdruck eines anderen Realitätsverständnisses als dies im Positivismus oder dem Kritischen Rationalismus zum Ausdruck kommt. Positivismus und Kritischer Rationalismus vertreten im Prinzip einen Methodenmonismus, d.h. egal ob Naturwissenschaften oder Sozial- und Geisteswissenschaften, die methodischen Zugänge zur Wirklichkeit sind im Grunde die gleichen - die Sozialwissenschaften gehen im Prinzip nicht anders vor als Naturwissenschaften.
Im Gegensatz dazu stehen andere erkenntnistheoretische Richtungen wie der Pragmatismus, die Phänomenologie oder die kritische Theorie, die einen Methodendualismus vertreten. D.h. sie vertreten die Auffassung, dass innerhalb der Sozial- und Geisteswissenschaften andere methodische Zugänge angewandt werden müssen, als in den Naturwissenschaften.
Der Pragmatismus bestreitet einen universalistischen Wahrheitsbegriff und geht davon aus, dass die Bedeutung einer Sache in den Konsequenzen, die sich aus dem praktischen Handeln ergeben, liegt. Diese Konsequenzen müssen erfahren werden und diese Erfahrung sei immer perspektivisch geprägt. Die handlungspraktischen Konsequenzen, d.h die Bedeutung, werden somit zum Wahrheitskriterium innerhalb des Pragmatismus.
Im Pragmatismus sind etwa Reiz und Reaktion (Ursache und Wirkung) keine getrennten Einheiten sondern Phasen einer Handlung. Der Reiz wird erst durch aktives Wahrnehmen und Interpretieren zu einem relevanten Teil der Handlung, d.h. die analytische Trennung von Ursache und Wirkung wird als problematisch angesehen, weil die Ursachen nicht aus sich selbst heraus wirken, sondern nur so, wie sie von den Akteuren im Handeln aktiv rezipiert werden. Insofern spielt der Kontext der Handlung eine zentrale Rolle, da er einerseits Handlungen beeinflusst, aber andererseits auch durch Handlungen konstituiert wird.
Als methodologische Konsequenzen ergeben sich die prozessuale Integration von Datenerhebung, Analyse und Theoriebildung[1]. Idealtypisch kann hier der Ablauf der Forschung innerhalb der Grounded Theory genannt werden, welcher auf eine strikte Trennung von Datenerhebung und -analyse verzichtet.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 4.2
2.3.3 Die Phänomenologie
Die Phänomenologie (griechisch phainomenon „Sichtbares, Erscheinung“; logos „Rede, Lehre“) ist die Lehre bzw. Untersuchung der Erscheinungen, des Phänomens als Gegebenes im Gegensatz zum Logos, der Zugangsart.
Die Phänomenologie ist eine vom deutschen Philosophen Edmund Husserl (1859- 1928) begründete Erkenntnistheorie, mit der er den Gegensatz zwischen Empirismus und Rationalismus[1] zu überwinden versuchte.
Husserl formulierte den Anspruch, zu den "Dingen selbst" zurück zu kehren. Die Welt sollte so begriffen werden, wie sie von den Handelnden erfahren wird. Zuerst sollten also die Konzepte, mit denen die Menschen im Alltag Probleme, Situationen und Ereignisse erfassen und deuten, beschrieben werden. Diese dienen dann der weiteren Theoriebildung. Der Ursprung der Erkenntnisgewinnung liegt im unmittelbar Gegebenen, in der Intentionalität des Bewusstseins, in der es einen Gegenstand erfasst. Husserl versucht auf Grundlage des intentionalen Charakters des Bewusstseins die Spaltung der Welt in Subjekt und Objekt aufzuheben. Er geht von einer Komplementarität von Welt und Bewusstsein aus. Das heißt, es existiert weder ein Primat der Welt noch der Wahrnehmung, sondern Handelnde erfahren sich immer "gleichursprünglich in der Welt".
Die zentralen methodischen Verfahren, die sich aus der Husserl’schen Philosophie ergeben, werden auch unter dem Begriff der phänomenologischen Reduktion subsumiert. Bei Husserl gehören dazu die Epoché, die mit ihr in Zusammenhang stehende eidetische Reduktion und die eidetische Variation.
Ausgangspunkt ist dabei die "natürliche Einstellung zur Welt", die auf der Annahme beruht, dass die Realität objektiv gegeben ist. Diese "Generalthesis der natürlichen Einstellung zur Welt" problematisiert Husserl und seine methodischen Anweisungen zielen darauf ab, diese "fraglose Geltung in eine begründete Geltung der Realität zu überführen" (Prechtl "1991: 58). Ein erster methodischer Schritt auf diesem Weg ist das Innehalten, das Einklammern und Ausschließen unserer Annahmen und des Vorwissens über die Welt. Diesen Prozess nennt Husserl Epoché, der dazu führen soll, die Welt von einem anderen Bewusstsein aus als neutraler Zuschauer zu betrachten, "der den Glauben an die Welt zunächst einmal nicht mitvollzieht" (ebd.: 59). Durch diesen Akt kann die Welt als "Korrelat der Subjektivität des Bewusstseins" erkannt und das Wesen des betrachteten Gegenstandes wahrgenommen werden. Diese Wesensschau nennt Husserl eidetische Reduktion.
In weiterer Folge geht es aber darum, eine Wesensbestimmung bzw. eine Identifikation der Wesensallgemeinheiten vorzunehmen, also den gleich bleibenden Kern bzw. die allgemeine Struktur zu identifizieren. Dafür setzt Husserl das Verfahren der eidetischen Variation ein, welche "von den Zufälligkeiten und individuellen Besonderheiten der faktisch ablaufenden Denkakte" (ebd.: 63) in Bezug auf den Gegenstand abstrahiert.
Husserls Phänomenologie wurde innerhalb der Kultur- und Sozialanthropologie im deutschsprachigen Raum insbesondere durch die Arbeiten von Leo Frobenius und Adolf Ellegard Jensen aufgenommen und weitergeführt.
Innerhalb der französischen Kultur- und Sozialanthropologie war es Maurice Merleau Ponty[2], der aufbauend auf Husserl eine eigenständige phänomenologische Position entwickelte (Phänomenologie der Wahrnehmung 1974 [1945]). In dieser Konzeption spielt der Leib, als Summe der intentionalen Erfahrungen jenseits von Körper und Seele, eine zentrale Rolle.
Innerhalb der Soziologie wurde die Husserl’sche Phänomenologie insbesondere in den Arbeiten von Alfred Schütz[3] und Thomas Luckmann zu den Strukturen der Lebenswelt und zur Phänomenologie des Alltagswissens weiterentwickelt.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 2.5
[2] http://plato.stanford.edu/entries/merleau-ponty/
[3] http://plato.stanford.edu/entries/schutz/
2.4 Emisch und etisch
Die Unterscheidung von emisch und etisch geht auf den linguistischen Anthropologen Kenneth Pike[1] zurück und wurde vom Kulturmaterialisten Marvin Harris[2] im anthropologischen Diskus popularisiert. Im Kern handelt es sich dabei um die Unterscheidung von Kategorien, die entweder von außen an einen Untersuchungsgegenstand herangetragen werden (etisch) oder aber um kultur- und sprachspezifische Kategorien und Unterscheidungen, die von den Untersuchten selbst zur Benennung und dem Verständnis von Phänomenen herangezogen werden (emisch).
In dieser Unterscheidung kommen auch unterschiedliche Wissenschaftsauffassungen zum Ausdruck. Eine etische Herangehensweise zielt auf die Formulierung allgemeiner Gesetzmäßigkeiten auf Basis einer wissenschaftlichen Terminologie ab, während ein emisches Verständnis versucht die kulturspezifischen Logiken und Unterscheidungen zu erforschen.
Innerhalb der Wissenschaft ist es unmöglich völlig emische Darstellungsweisen anderer Kulturen zu produzieren, da diese außerhalb ihres kulturellen und sprachlichen Ursprungskontexts unverständlich bleiben würden. Die Darstellung kultureller Phänomene hat immer auch mit der Übersetzung und Transformation kultureller Spezifitäten in eine andere, für die intendierte Leserschaft verständliche Terminologie zu tun. Andererseits tendiert eine rein etische Terminologie, jenseits kulturspezifischer Logiken und Unterscheidungen dazu, potentiell eurozentrische Axiome des westlichen Wissenschaftsdiskurses zu reproduzieren. Ziel einer Kultur- und Sozialanthropologie, die zu allgemeineren Aussagen mittlerer Reichweite kommen will, sollte die Entwicklung einer Terminologie sein, die zwischen diesen beiden Positionen vermittelt. Sie sollte über den kulturspezifischen Einzelfall hinausgehen aber dennoch kultursensibel sein und unzulängliche universalistische Verallgemeinerungen kritisieren.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Lee_Pike
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Marvin_Harris
2.5 Empiristen versus Rationalisten
Eine weitere Unterscheidung, die auf die Wissenschaftsentwicklung des 19. Jahrhunderts zurückgeht, ist jene zwischen Rationalismus und Empirismus. Der Rationalismus (lateinisch ratio "Vernunft") geht von der Möglichkeit einer vernunftgeleiteten Erkenntnis der Wirklichkeit aus, während der Empirismus (griechisch εμπειρισμa2;ς "von der Empirie", lateinisch experientia "Erfahrung") die Erfahrung bzw. die sinnliche Wahrnehmung als zentrales Strategie der Erkenntnis betont.
Diese unterschiedlichen Herangehensweisen haben auch nationale Wissenschaftstraditionen geprägt. So steht der Rationalismus insbesondere mit der französischen Tradition in Zusammenhang (z.B. René Descartes). Innerhalb der Kultur- und Sozialanthropologie findet diese Position auch in den von einer deduktivistischen[1] Grundhaltung geprägten Arbeiten von Emile Durkheim, Claude Lévi-Strauss aber auch marxistisch orientierten Autoren, wie Maurice Godelier ihren Niederschlag. Ihnen ist eine skeptische Haltung gegenüber dem Empirismus zumindest insofern gemeinsam, als sie die Aussagen der Informanten nicht als mehr oder weniger direkte und letztendliche Darstellung der Realität betrachten.
Im Gegensatz dazu steht der Empirismus mit der anglosächsischen Wissenschaftstradition und Autoren, wie John Locke und David Hume in engem Zusammenhang. Typische Schlussweisen des Empirismus sind die Induktion[2] und die Abduktion[3]. Nicht zufällig spielte in der britischen, aber auch in der US-amerikanischen Sozialanthropologie die empirische Feldforschung (Bronislaw Malinowski[4], Franz Boas[5]) früher eine wichtige Rolle für die anthropologische Theorieentwicklung als in der französischen Tradition.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-6.html
[2] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-5.html
[3] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-7.html
[4] Siehe Kapitel 1.4
[5] http://www.personenlexikon.net/d/franz-boas/franz-boas.htm
2.6 Arten von Theorien
Eine Theorie ist eine Menge logisch miteinander verknüpfter Aussagen, die einen bestimmten Ausschnitt der Welt erklären.
Diesen Aussagen liegen immer auch nicht weiter hinterfragte Axiome zugrunde, die bei wissenschaftlichen Theorien auf deren wissenschaftstheoretische Positionen verweisen. Deshalb ist es möglich auf einer allgemeinen Ebene zwischen z.B. positivistischen und idealistischen, materialistischen oder phänomenologischen, essentialistischen oder konstruktivistischen Theorien zu unterscheiden.
In Bezug auf konkrete Forschungsvorhaben können etablierte Theorien einen Ausgangspunkt darstellen, von dem aus Hypothesen abgeleitet und Erhebungsinstrumente für die Überprüfung derselben entwickelt werden. Neben dieser theorieprüfenden Vorgangsweise kann es aber auch das Ziel insbesondere qualitativer Forschungsvorhaben sein, Theorien und Hypothesen aus den empirischen Daten zu entwickeln (siehe z.B. Grounded Theory[1]). Theorien als logisch miteinander verknüpfte Aussagen können auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus angesiedelt sein. Rene König (1973) hat z.B. folgende Arten von Theorien nach aufsteigendem Abstraktionsgrad unterschieden:
- Beobachtung empirischer Regelmäßigkeiten:
Die bloße Beobachtung empirischer Regelmäßigkeiten beschränkt sich zumeist auf die rein deskriptive Feststellung von Erscheinungen, die noch keine theoretische Erklärung über deren Entstehung beinhalten.
- Entwicklung von ad-hoc Theorien:
Diese erlauben räumlich und zeitlich beschränkte Aussagen über bestimmte Phänomene, ohne daraus Erkenntnisse allgemeinerer Art abzuleiten.
- Theorien mittlerer Reichweite:
Der Begriff Theorien mittlerer Reichweite stammt von Robert Merton[2] und bezieht sich auf klar abgegrenzte Aspekte der sozialen Realität. Diese Theorien gelten nicht für alle Gesellschaften und für alle Bereiche einer Gesellschaft, sondern beanspruchen Gültigkeit für ausgewählte Bereiche sozialer Realität. Dabei handelt es sich um die innerhalb der Sozialwissenschaften am häufigsten verwendeten und angestrebten Theorien.
- Theorien höherer Komplexität:
Bei Theorien höherer Komplexität handelt es sich um allgemeine Aussagen, die in der Praxis aber aufgrund ihres Abstraktionsniveaus zumeist schwer oder kaum Gegenstand empirischer Forschung und Überprüfung sein können.
Abbildung: Abstraktionsgrad von TheorienAbbildung: Abstraktionsgrad von Theorien und Häufigkeit ihrer Überprüfung
(aus Atteslander, Peter 2000: 37)
Nicht jede Theorie, die einen bestimmten Ausschnitt der Welt erklärt, beruht auf der systematischen empirischen Beobachtung von Regelmäßigkeiten und/oder auf der logischen Widerspruchsfreiheit ihrer Aussagen. Dennoch kann es sich dabei um eine Menge von Aussagen handeln, die einen bestimmten Ausschnitt der Welt erklären auf empirischen Erfahrungen beruhen und alltagsweltliche Orientierungshilfen und Erklärungen zur Verfügung stellen. In diesem Fall sprechen wir von mehr oder weniger elaborierten Alltagstheorien. Diese können innerhalb der Kultur- und Sozialanthropologie zum Gegenstand der Untersuchung werden und bieten einen zentralen Zugang zu lokalen Weltbildern, Normen und Moralvorstellungen. Die Untersuchung von Alltagstheorien kann aber auch Stereotype und Vorurteile gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen deutlich machen.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-122.html
[2] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/organthro/organthro-24.html
2.7 Begriffsbildung, Begriffsdefinitionen und Begriffsrelationen
In der empirischen Sozialforschung spielt neben den wissenschaftstheoretischen Positionen und den unterschiedlichen Arten von Theorien die Begriffsbildung, Begriffsdefinitionen sowie die Relationen zwischen den Begriffen eine zentrale Rolle.
Je nach Erkenntnisinteresse und gewählter Forschungsstrategie (Forschungsablauf[1]) stellt sich das Problem der Begriffsbestimmung auf unterschiedliche Art und Weise. Wenn man z.B. von existierenden Theorien ausgeht und diese zur Grundlage einer Untersuchung macht, so ist es notwendig, die in diesen Theorien und den davon abgeleiteten Hypothesen vorkommenden Begriffe zu definieren.
Wenn man hingegen die empirischen Daten als Ausgangspunkt der Theoriebildung nimmt, bzw. den kulturspezifischen Bedeutungsbereich bestimmter lokal verwendeter Begriffe bestimmen will, so wird man diese nicht im Vorfeld definitorisch bestimmen, sondern auf Basis des empirischen Materials eine Begriffsbildung vornehmen.
Die Begriffsbildung kann sich also sowohl auf emische wie auf etische Begriffe[2] beziehen und die Bedeutung des Begriffes sowohl deduktiv[3] festlegen, wie induktiv[4] erschließen.
Darüber hinaus werden verschiedene Begriffe in wissenschaftlichen Aussagen auch miteinander in Beziehung gesetzt. Solche Begirffsrelationen kommen unter anderem in Theorien[5], Klassifikationen[6], Typologien[7], Hypothesen und Taxonomien[8] zum Ausdruck.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 4
[2] Siehe Kapitel 2.4
[3] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-6.html
[4] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-5.html
[5] Siehe Kapitel 2.6
[6] Siehe Kapitel 2.7.3.1
[7] Siehe Kapitel 2.7.3.3
[8] Siehe Kapitel 2.7.3.2
2.7.1 Die Begriffsdefinition
Begriffe sind zu definieren und eindeutig und einheitlich zu verwenden. Ein Begriff enthält dadurch eine offen gelegte Zuordnung bestimmter Merkmale.
Bei expliziten Definitionen wird der zu definierende Begriff (Definiendum) durch einen neuen Ausdruck (Definiens) ersetzt. Der zu definierende Begriff und der neue Ausdruck können ausgetauscht werden, d.h sie sind äquivalent. Dies ist bei impliziten oder partiellen Definitionen, die nur eine teilweise Definition des Begriffs darstellen, nicht der Fall.
Um Begriffe zu definieren kann man unterschiedlich vorgehen:
Erstens kann man eine Begriffsexplikation vornehmen und dadurch seinen Inhalt und Umfang bestimmen. Dies kann mittels analytischer Definition (einer theoretischen Bedeutungsanalyse) oder aber mittels empirischer Analyse (der beobachtbaren Ausprägungen des Begriffs) erfolgen, die einen bekannten Begriff durch andere Begriffe exakter definiert. Solche Definitionen finden sich oft in Wörterbüchern.
z.B. Waffen, alle physischen Mittel, die zur Bekämpfung von Zielen dienen und sowohl zum Angriff, wie auch zur Verteidigung eingesetzt werden.
z.B. Waffen, Hieb- und Stichwaffen, Schlagwaffen, Feuerwaffen, Waffen auf Basis von Spreng- und Splitterwirkung, chemische Waffen, biologische Waffen, atomare Waffen
Eine zweite wichtige Art der Definition sind Nominaldefinitionen. Hier soll ein neuer Begriff durch einen bekannten ersetzt werden.
z.B. eine Großstadt ist jede Siedlung mit mehr als 100 000 Einwohnern
z.B. eine kinderreiche Familie ist jede Familie mit drei oder mehr Kindern
Eine dritte zentrale Art der Definition, die insbesondere in der quantitativen Sozialforschung relevant ist und theoretische Begriffe empirisch fassbar macht, ist die operationale Definition. Operationale Definitionen sind im Normalfall partielle Definitionen.
2.7.1.1 Operationale Definition: Operationalisierung
"Unter Operationalisierung versteht man die Schritte der Zuordnung von empirisch erfassbaren, zu beobachtenden oder zu erfragenden Indikatoren zu einem theoretischen Begriff. Durch Operationalisierung werden Messungen der durch einen Begriff bezeichneten empirischen Erscheinungen möglich." (Atteslander 2000: 50)
Im Zentrum einer operationalen Definition steht also das Anliegen, theoretische Begriffe empirisch fassbar bzw. messbar zu machen. So hat jeder ein Alltagsverständnis des theoretischen Begriffs "Soziale Ungleichheit". Was bedeutet es aber, wenn man soziale Ungleichheit empirisch fassbar machen will? Welche Variablen (ein in verschiedenen Ausprägungen vorhandenes Merkmal eines Untersuchungsgegenstandes) des Begriffs soziale Ungleichheit lassen sich benennen und welche davon will man in die Definition und Untersuchung mit aufnehmen?
Eine Operationalisierung dieses Begriffs könnte unter anderem auf folgende Merkmale (Variablen) stoßen:
Einkommen, Bildung, Geschlecht, Wohnsituation, etc.
Weiters muss man sich im Zuge einer Operationalisierung fragen, durch welche direkt beobachtbaren Variablen (Indikatoren) nun z.B. ein Merkmal, wie Einkommen, gemessen wird. Wird nach dem Familieneinkommen oder nach dem individuellen Verdienst gefragt, inwieweit werden andere Vermögenswerte (Erspartes, Immobilien etc.) oder nicht "offizielle" Einkommensquellen (z.B. Taschengeld, Zuwendungen von Verwandten) berücksichtigt?
Insgesamt werden im Zuge der Operationalisierung also theoretische oder abstrakte Begriffe, welche nicht direkt messbar sind, durch die Zuordnung von Indikatoren, die als Stellvertreter für den abstrakten Begriff fungieren, operationalisiert und dadurch messbar gemacht.
Dies lässt sich auch an folgendem Beispiel zum Begriff des Studienerfolgs veranschaulichen.
Abbildung: Operationalisierung des Begriffs "Studienerfolg"Abbildung: Operationalisierung des Begriffs "Studienerfolg"
(aus Atteslander 2000: 52)
2.7.2 Die Begriffsbildung
Wenn man innerhalb der Kultur- und Sozialanthropologie die lokale Bedeutung von Begriffen erfassen will, so lässt sich dies nicht auf Basis analytischer Definition (einer theoretischen Bedeutungsanalyse) oder empirischer Analyse der beobachtbaren Ausprägungen des Begriffs alleine bewerkstelligen. Vielmehr geht es darum, den Bedeutungsgehalt zu bestimmen, mit dem ein bestimmter Begriff in einem spezifischen soziokulturellen Kontext assoziiert ist. Dazu ist es notwendig, festzustellen, was unter einen Begriff fällt, aber auch was seine Relationen zu anderen Begriffen sind. Dazu können unterschiedliche Verfahren eingesetzt werden.
Spradley (1979) benennt zu diesem Zweck in seiner Konzeption des ethnographischen Interviews[1] unterschiedliche Fragearten und Analysestrategien.
- Kontrastfragen werden dazu eingesetzt, um heraus zu finden, was der Informant mit den verschiedenen Begrifflichkeiten meint, die er in seiner Sprache verwendet und wie sich diese von einander unterscheiden.
- Das Ziel von strukturellen Fragen ist es herauszufinden, wie der/die InformantIn sein/ihr Wissen in bestimmten kulturellen Bereichen (domains) organisiert.
In weiterer Folge geht es dann um die semantischen Beziehungen zwischen den Begriffen (domain analysis), die Unterschiede zwischen den Begriffen (Komponentialanalyse) und die Feststellung der Relationen zwischen untergeordneten Begriffen und ihrer Beziehung zu einem übergeordneten Begriff bzw. Konzept (taxonomische Analyse[2]).
Auf einem etwas abstrakteren Niveau, welches nicht ausschließlich auf den lokalen Sinngehalt emischer Begrifflichkeiten abstellt, stellen auch die unterschiedlichen Strategien zu Entwicklung von Kodes[3] und Konzepten Verfahren der Begriffsbildung im Vorfeld der Entwicklung von Theorien dar.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-47.html
[2] Siehe Kapitel 2.7.3.2
[3] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-118.html
2.7.3 Die Begriffsrelationen
Um zu wissenschaftlichen Aussagen zu komme, ist es notwendig, verschiedene Begriffe miteinander in Beziehung zu setzten. Bei diesen Beziehungen kann es sich um Äquivalenzbeziehungen im Sinne von Definitionen[1] handeln. Es können aber auch Beziehungen zwischen Begriffen hergestellt werden, die weder teilweise noch völlig deckungsgleich sein dürfen, wie dies bei Hypothesen[2] der Fall ist. Neben den Definitionen und Hypothesen existieren aber auch komplexere Formen von Begriffsrelationen, wie etwa Theorien[3], Klassifikationen, Typologien und Taxonomien.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 2.7.1
[2] Siehe Kapitel 2.7.4
[3] Siehe Kapitel 2.6
2.7.3.1 Klassifikation
Die klassische Form der Klassifikation dient dazu, Ordnungen in einen Objektbereich zu bringen und diesen an Hand von Merkmalen zu strukturieren. Die einzelnen Elemente sind dabei durch bestimmte Merkmalsausprägungen charakterisiert. Bestimmte Merkmale bzw. Dimensionen der Elemente werden dabei in Klassen zusammengefasst. Eine einfache Art der Klassenbildung beruht darauf, festzustellen, ob ein bestimmtes Merkmal vorhanden ist oder nicht. Eine weitere kann sich darauf beziehen, in welchem Ausmaß ein Merkmal vorhanden ist (z.B. 0-10 Jahre, 11-20 Jahre etc). Auf dieser Basis lassen sich Elemente einzelnen Klassen zuordnen.
Die traditionelle Auffassung einer Klasse geht davon aus, dass diese durch die durchgehende Präsenz gewisser gemeinsamer Eigenschaften gekennzeichnet ist. Eine Klassifikation in diesem Sinne hat folgenden drei Anforderungen zu genügen:
| Eindeutigkeit | Das heißt, jedem Element des Forschungsgegenstandes muss die Ausprägung eines Merkmals zugeschrieben werden können. |
| Ausschließlichkeit | Wenn für jedes Objekt nur eine und nicht mehrere Ausprägungen des Merkmals zutreffen. |
| Vollständigkeit | Ist dann gegeben, wenn die ersten beiden Bedingungen erfüllt sind und kein Objekt ohne Merkmalsausprägung ist. |
Eine komplexere Art von Klassifikation stellen Taxonomien[1] dar.
An dieser Art der Klassifikation wurde verschiedentlich Kritik geübt. So hat etwa Wittgenstein (1953, 1958) gezeigt, dass verbale Konzepte im Normalfall nicht auf dieser Basis konstruiert werden. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes Netzwerk überlappender Ähnlichkeiten und Überschneidungen. Dabei können übergeordnete Ähnlichkeiten existieren aber auch solche, die sich nur auf gewisse Details beziehen. Wittgenstein hat dafür den Begriff der Familienähnlichkeiten verwendet. Auch in den Untersuchungsfeldern der Kultur- und Sozialanthropologie haben wir es selten mit Klassifikationen zu tun, die auf den Prinzipien der Eindeutigkeit, Ausschließlichkeit und Vollständigkeit beruhen.
Rodney Needham (1975) hat deshalb hat das Konzept der polythetischen Klassifikation in Anlehnung an Sneath (1962) in die Kultur- und Sozialanthropologie eingeführt. Solche Klassifikationen sind weder völlig ausschließlich, noch eindeutig. Das heißt, solche polythetischen Klassen beruhen zwar auf einer Ähnlichkeit, diese Ähnlichkeit beruht aber nicht auf einem einzigen Merkmal und die einzelnen Elemente, die unter eine solche Klassifikation subsumiert werden, können deshalb sehr unterschiedlich von einander sein. Eine solche polythetische Klassifikation führt Elemente zusammen, die die größte Anzahl gleicher Eigenschaften aufweisen, aber keine einzige dieser Eigenschaften ist notwendige Voraussetzung für die Klassenmitgliedschaft und sie ist kein hinreichendes Kriterium um ein Element einer Klasse hinzuzufügen.
So argumentiert Needham, dass etwa Abstammungssysteme keine Klasse im herkömmlichen Sinn darstellen. Er identifiziert vielmehr unterschiedliche Merkmale für Abstammungssysteme, wobei aber weder jede Gesellschaft alle diese Merkmale aufweisen muss, noch müssen alle Gesellschaften, die durch Abstammungssysteme charakterisiert sind, eines dieser Merkmale gemeinsam haben. Needham veranschaulicht dies wie folgt, wobei die Großbuchstaben (A,B,C) Abstammungssysteme und die Kleinbuchstaben ihre jeweiligen Eigenschafen bezeichnen. So gehören A und C zwar derselben Klasse im Sinne einer polythetischen Klassifikation an, haben aber keine der identifizierten Eigenschaften gemeinsam.
| A | p | q | r | ||||
| B | r | s | t | ||||
| C | t | u | v |
Tabelle: Serielle Ähnlichkeiten unter Abstammungssystemen (nach Needham 1975: 351)
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 2.7.3.2
2.7.3.2 Taxonomie
Eine Taxonomie (v. griech. táxis „Ordnung“, -nómos „Gesetz“) ist eine in der Regel hierarchische Klassifikation von Elementen in begriffliche Gruppen (Klassen, Unterklassen etc.). Am bekanntesten sind vermutlich die biologischen Taxonomien der Lebewesen. z.B. des Homo sapiens sapiens als Teil des Tierreiches
| Kategorie | Taxon des Homo sapiens sapiens |
| REICH | Tierreich |
| Unterreich | Metazoa (Vielzeller) |
| Abteilung | Histozoa (Gewebetiere) |
| Unterabteilung | Bilateria (Zweiseitig-Symmetrische) |
| STAMM (Phylum) | Chordata (Chordatiere) |
| Unterstamm | Vertebrata (Wirbeltiere) |
| KLASSE | Mammalia (Säugetiere) |
| Unterklasse | Theria (eigentliche Säuger) |
| Überordnung | Eutheria (höhere Säugetiere) |
| ORDNUNG | Primates (Herrentiere) |
| Unterordnung | Simiae (Echte Affen) |
| Superfamilie (Überfamilie) | Hominoidae (Menschenähnliche) |
| FAMILIE | Hominidae (Menschenartige) |
| Unterfamilie | Homininae |
| GATTUNG (Genus) | Homo |
| Untergattung (Subgenus) | - |
| ART (Spezies) | sapiens |
| Unterart (Subspezies) | sapiens |
Tabelle: Taxonomische Einordnung des homo sapiens sapiens, beruhend auf der Systematik der Primaten[1].
Die Kultur- und Sozialanthropologie macht insbesondere darauf aufmerksam, dass solche Kategoriensysteme eine raum-zeitliche Kulturgebundenheit aufweisen. Eine der Aufgaben, die sich im Zuge der empirischen Forschung stellt, ist die Frage, wie so genannte Alltagstaxonomien (folk taxonomies) organisiert sind. Diese kommen im alltäglichen Sprachgebrauch zum Ausdruck und sind Teil der lokalen soziokulturellen Konzeptionen der Welt.
Spradley (1979: 142ff) schlägt folgende Schritte für eine taxonomische Analyse von Alltagsbereichen vor:
Tabelle: Taxonomie eines TunfischbootesTabelle: Taxonomie eines Tunfischbootes
(aus Spradley 1979: 139)
File:Images/ksamethoden-47 1.jpgTabelle: Taxonomie eines Tunfischbootes
(aus Spradley 1979: 139)
1) Auswahl eines Bereiches für die taxonomische Analyse
2) Identifizierung eines angemessen Rahmens für die Analyse der alternativer Subkategorien auf Basis der zentralen semantischen Beziehung zwischen übergeordneten und einem untergeordneten Begriff
3) Suche nach möglichen Subkategorien der untergeordneten Begrifflichkeiten
4) Die Suche nach möglichen größeren, inklusiveren Bereichen, die den Bereich den man analysiert inkludieren
5) Konstruktion einer vorläufigen Taxonomie
6) Die Formulierung struktureller Fragen, um die taxonomischen Beziehungen zu verifizieren und neue Begrifflichkeiten zu eruieren
7) durchführen zusätzlicher struktureller Interviews
8) Konstruktion der vollständigen Taxonomie
Als Beispiel einer solchen Analyse kann man fragen welche Teile eines Bootes zum Thunfischfischen unterschieden werden und wie diese Unterscheidungen hierarchisch organisiert sind:
ad 1) Der Bereich einer taxonomischen Analyse sind die Teile eines Boot zum Tunfischfischen.
ad 2) Das Deck ist ein Teil des Bootes. "ist Teil des" ist die zentrale semantische Beziehung. Was sind alternative Subkategorien? Das heißt, was ist neben dem Deck noch Teil des Bootes? Zum Beispiel der Mast, der Maschinenraum, der Schraubentunnel (shaft alley, das ist jener Teil der vom Maschinenraum zum Vorsteven, einer Verlängerung des Rumpfes reicht, der die Antriebswelle beinhaltet).
ad 3) Was sind Subkategorien jener Kategorien, die Teil des Bootes sind?
ad 4) Was sind übergeordnete Kategorien des Tunfischbootes? Ist ein Tunfischboot Teil einer übergeordneten Kategorie von Booten?
etc...
Am Ende könnte man zu folgender Taxonomie dieses Bootes kommen:
Gleichzeitig macht dieses scheinbar eindeutige Beispiel auch deutlich, dass unterschiedliche Klassifikationslogiken in diesem Bereich vorliegen können. So kann das Thunfischboot Teil unterschiedlicher übergeordneter Kategorien sein, z.B. der Fischerboote, der Motorboote, etc.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.tierseiten.com/affen/affensystematik.html
2.7.3.3 Typologie
Typologien und die von diesen unterschiedenen einzelnen Typen ordnen eine Vielzahl von Erscheinungen in überschaubare Gruppen. Sie ermöglichen es die Gruppen voneinander unterscheidbar zu machen.
Dabei wird eine Menge von Objekten "mit Hilfe von Merkmalen definiert, von denen man weder weiß ob sie hinreichend sind, noch, ob man eine vollständige Klassifikation vornehmen kann." (Friedrichs 1980: 89) Typologien sind ein Vorgriff auf explizite Theoriebildung.
Eine besondere Art der Typologie ist der Idealtypus nach Max Weber. Dabei handelt es sich um theoretische Konstrukte, die gezielt zentrale Aspekte von Phänomenen hervorheben, um diese gedanklich zu ordnen und unterscheiden zu können, auch wenn die Phänomene selbst in der Realität nie bzw. selten in dieser reinen idealtypischen Form auftreten. Bekannte Beispiele für solche idealtypischen Unterscheidungen sind etwa Max Webers Handlungstypen und die darauf aufbauenden idealtypischen Formen von Herrschaft. So unterscheidet Weberzwischen folgenden Handlungstypen:
- das zweckrationale Handeln auf Basis der Abwägung von Mittel, Zweck und Folgen;
- das wertrationale Handeln auf Basis des Glaubens an den Eigenwert einer bestimmten Art und Weise zu Handeln;
- das traditionelle Handeln auf Basis eingelebter Gewohnheit;
- Das affektuelle Handeln auf Basis von Gefühlslagen und Affekten;
oder aber in Bezug auf die Typen legitimer Herrschaft[1], die rationale (bürokratische), die traditionelle und die charismatische Herrschaft.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.uni-muenster.de/FNZ-Online/theorien/modernisierung/quellen/weber.htm
2.7.4 Hypothesen
Der Satz "Je mehr Studierende arbeiten müssen, um sich das Studium zu finanzieren, desto länger ist die Studiendauer." ist eine typische Hypothese.
Wodurch zeichnet sich eine Hypothese aus?
- Eine Hypothese ist ein mit Begriffen formulierter Satz.
- Sie ist eine Aussage, keine Frage, kein Befehl;
- Eine solche Aussage enthält mindestens zwei semantisch relevante Begriffe.
- Die Aussage ist nicht tautologisch. Ein Begriff darf den anderen weder völlig noch teilweise abdecken. (Im Gegensatz zu einer Definition[1])
- Diese Begriffe sind durch einen logischen Operator (wenn - dann) verbunden.
- Die Aussage ist widerspruchsfrei.
- Die empirischen Geltungsbedingungen sind aufgezählt.
- Die Begriffe sind auf Wirklichkeitsphänomene hin operationalisierbar.
- Die Aussage ist falsifizierbar[2]. (siehe Atteslander 2000: 45f)
Was sind in der angeführten Hypothese die semantisch relevanten Begriffe? Studierende, arbeiten, Studiendauer
Der logische Operator ist je mehr - desto länger.
Die empirischen Geltungsbedingungen sind in dieser Hypothese aufgezählt. Sie gilt für Studierende, die sich durch Arbeit (zumindest teilweise) das Studium finanzieren müssen.
Dass die Begriffe auf Wirklichkeitsphänomene hin operationalisierbar sind, bedeutet, dass für jeden der Begriffe angegeben werden kann, wer bzw. was darunter fällt und wie dies gemessen werden kann. So muss z.B. festgelegt werden, was im Zuge der Untersuchung unter den Begriff "Studierende/r" verstanden wird. Handelt es sich dabei um Studierende an öffentlichen/privaten Universitäten, an Fachhochschulen, an Akademien etc.? Wo? In Österreich, in Wien, an bestimmten Bildungseinrichtungen etc. oder handelt es sich nur um Studierende bestimmter ausgewählter Studienrichtungen etc.?
Da im Zuge von Forschungsprojekten nicht alle aktuellen, vergangenen und zukünftigen Studierenden untersucht werden können, lässt sich eine solche Hypothese nicht bestätigen bzw. verifizieren. Dafür wäre die Kenntnis aller Fälle notwendig. Deshalb sollten nach Popper[3] Hypothesen falsifizierbar sein, d.h. durch neue empirische Erkenntnisse widerlegbar sein.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 2.7.1
[2] Siehe Kapitel 2.2.1
[3] Siehe Kapitel 2.2.1
2.8 Literatur
Adorno, Theodor W. et al. (1978): Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. DTV Deutscher Taschenbuch Verlag, Darmstadt.
Atteslander, Peter (2000): Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin. de Gruyter, New York.
Bryman, Alan (2001): Introduction: A Review of Ethnography. In: Alan Bryman (Hg.): Ethnography. Sage, London: S. IX -XXXIX.
Creswell, John W. (1994): Research design: Qualitative and quantitative and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, Sage.
Geertz, Clifford (2001): "From the Native´s Point of View": On the Nature of Anthropological Understanding. In: Alan Bryman (Hg.): Ethnography. Sage, Loondon: S. 258-270.
Gold, Raymond L. (2001): The Ethnographic Method in Sociology. In: Alan Bryman (Hg.): Ethnography. Sage, Loondon: S. 289-303.
Heider, Karl G. (2001): The Rashomon Effect: When Ethnographers Disagree. In: Alan Bryman (Hg.): Ethnography. Sage, Loondon: S. 398-408.
Johannsen, Agneta M. (2001): Applied Anthropology and Post-Modernist Ethnography. In: Alan Bryman (ed.): Ethnography. Sage, Loondon: S. 328-349.
König, René (Hrsg.) (1973): Handbuch der empirischen Sozialforschung. Band 2: Grundlegende Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung: erster Teil. Enke: Stuttgart.
Kuhn, Thomas S. (1967): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Suhrkamp, Frankfurt am Main.
Lang, Hartmut (1994): Wissenschaftstheorie für die ethnologische Praxis. Dietrich Reimer Verlag: Berlin. [2. Auflage]
Needham, Rodney (1975): Polythetic Classification: Convergence and Consequences. Man 10 (3): S. 349-369.
Popper, Karl Raimund (1994 [1935]): Logik der Forschung. Mohr, Tübingen.
Porter, Sam (2001): Critical Realist Ethnography: The Case of Racism and Professionalism in a Medical Setting. In: Alan Bryman (Hg.): Ethnography. Sage, London: S. 239-257.
Prechtl, Peter (1991): Husserl zur Einführung. Junius Verlag, Hamburg.
Salamone, Frank A. (2001): Epistemological Implications of Fieldwork and Their Consequences. In: Alan Bryman (Hg.): Ethnography. Sage, London: S. 271-288.
Salzman, Philip Carl (1996): Methodology. In: Barnard, Alan; Spencer, Jonathan (Hrsg.): Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Routledge.
Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (1993): Philosophische Überlegungen zum Verstehen fremder Kulturen und zu einer Theorie der menschlichen Kultur. In: Stagl, Justin; Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (Hrsg.): Grundfragen der Ethnologie. Dietrich Reimer Verlag, Berlin: S. 51-92.
Stagl, Justin (1993): Szientistische, hermeneutische und phänomenologische Grundlagen der Ethnologie. In: Wolfdietrich, Schmied-Kowarzik; Stagl, Justin (Hrsg.): Grundfragen der Ethnologie. Dietrich Reimer Verlag, Berlin: S. 15-50.
3 Projektentwicklung: von der Idee zum Forschungsprojekt
Im Folgenden werden einige zentrale Probleme und Aufgaben, die bei der Entwicklung eines eigenen Forschungsprojekts bewältigt werden müssen, benannt, sowie einige ausgewählte Strategien zur Konkretisierung von wissenschaftlichen Fragestellungen, zur Erstellung von Forschungskonzepten sowie den Kontexten von Forschungsvorhaben vorgestellt.
3.1 Vom Interesse zur wissenschaftlichen Fragestellung
Eines der zentralen Probleme am Beginn einer eigenständigen Forschung ist es, von einem allgemeinen Interesse zu einem konkreten Forschungsvorhaben und einer damit zusammenhängenden wissenschaftlichen Fragestellung zu kommen.
Das allgemeine Interesse bzw. die Faszination, die Ausgangspunkt für ein wissenschaftliches Forschen sein kann, bezieht sich zumeist auf einen noch sehr allgemeinen Phänomenbereich. Darunter fallen etwa Forschungsinteressen wie "Minderheiten in Österreich", "die Lebenssituation von MigrantInnen" oder "Macht- bzw. Herrschaftsverhältnisse und Geschlechterrollen". Damit sind allgemeine Themen und Phänomenbereiche benannt, jedoch noch kein konkretes Forschungsvorhaben oder eine wissenschaftliche Fragestellung.
Oft stellt es eine nicht geringe Schwierigkeit dar, von solch spannenden, aber allzu allgemeinen Phänomenbereichen zu konkreten und bearbeitbaren Forschungsfragen zu kommen. Was kann man tun, um hier spezifischer zu werden?
Man kann z.B. den Phänomenbereich spezifizieren und darauf aufbauend gezielte Literaturrecherchen durchführen. Beide Strategien dienen auf Basis der Bearbeitung der identifizierten Literatur in weiterer Folge dazu, konkrete wissenschaftliche Fragestellungen zu formulieren und eine Vorgehensweise zur Beantwortung dieser Forschungsfragen zu entwickeln.
3.1.1 Spezifizierung des Phänomenbereichs
In einem ersten Schritt bietet es sich an, die allgemeinen Phänomenbereiche entlang zentraler Dimensionen genauer zu spezifizieren:
- sozial
- zeitlich
- räumlich
- sachlich
Was könnte das in Bezug auf das Thema "Minderheiten in Österreich" bedeuten?
In Bezug auf die soziale Dimension geht es um die Frage, was unter Minderheiten verstanden wird bzw. welche Minderheiten untersucht werden sollen? Ganz allgemein gefragt, geht es um Minderheiten in Bezug auf ihre Sexualität, ihre ethnische Identität, ihre körperliche bzw. psychische Beeinträchtigung, ihre Sprache etc.? Wenn es z.B. um ethnische Minderheiten gehen sollte, meint man damit jene österreichischen Bevölkerungsgruppen (Roma, Kroaten, Slowenen, Tschechen etc.), die offiziell als solche anerkannt sind oder um Bevölkerungsgruppen mit oder ohne österreichische Staatsbürgerschaft, die aufgrund von Migrationsprozessen in Österreich leben? Oder geht es einem noch spezifischer um die Situation von AsylwerberInnen?
In Bezug auf die zeitliche Spezifizierung stellt sich die Frage, auf welchen Zeitpunkt (synchron) bzw. welchen Zeitraum (diachron) sich die Untersuchung beziehen soll. Geht es um Minderheiten heute, um die Entwicklung der Minderheiten in Österreich seit 1918 oder noch umfassender um das Thema der Minderheiten in der K&K- Monarchie?
In Bezug auf die räumliche Dimension geht es um die Frage wo bzw. worauf in einem räumlichen Sinn sich die Untersuchung beziehen soll. Auf ganz Österreich, ein bestimmtes Bundesland, einen Bezirk von Wien oder doch nur auf einen bestimmten Markt oder ein Kulturzentrum?
In Bezug auf die Sachdimension stellt sich die Frage, was in Bezug auf Minderheiten untersucht werden soll. Ihr Zugang zum Arbeitsmarkt, ihre rechtliche Situation, ihre Wohnsituation, ihre sozialen Netzwerke, in wie weit sie Diskriminierungserfahrungen gemacht haben oder aber wie und in Bezug auf welche Themen in bestimmten Medien über Minderheiten in Österreich berichtet wird etc.?
Ein Thema, welches dann schon viel spezifischer als ein allgemeines Interesse an Minderheiten in Österreich ist, wäre etwa "Soziale Netzwerke von Jugendlichen der 3. Generation in den Wiener Vororten" zu untersuchen.
Wenn man ein Thema auf diese Art und Weise spezifiziert hat, macht es Sinn, nach vorhandenen Studien zu suchen, um das eigene Forschungsvorhaben zu konkretisieren und im Kontext bereits vorhandener Untersuchungen zu verankern. Dazu ist es notwendig eine gezielte Literaturrecherche[1] durchzuführen.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 3.1.2
3.1.2 Literaturrecherche
Für eine Literaturrecherche sind zwei Dinge zentral:
1. man muss wissen, wonach man sucht und
2. man muss wissen, wo man suchen kann.
Um festzulegen, wonach man sucht, empfiehlt es sich einzelne Schlagwörter festzulegen, die die Grundlage der Recherche bilden. Beim Thema "Soziale Netzwerke von Jugendlichen der 3. Generation in den Wiener Vororten" würde man einerseits Literatur zu sozialen Netzwerken, zu Jugendlichen der 3. Generation und zu Migration bzw. Minderheiten in Wiener Vororten suchen. Solche Begrifflichkeiten können nun unterschiedlich miteinander kombiniert werden, aber auch im Zuge der Recherche weiter spezifiziert werden.
Welche Möglichkeiten gibt es, um nach Literatur zu diesen Begriffen zu suchen?
Hierfür reichen Antworten wie "im Internet" bzw. "in der Bibliothek" bei weitem nicht aus!
Vielmehr benötigt man ein Verständnis dafür, dass man an unterschiedlichen Stellen nur bestimmte Arten von Literatur findet.
So wird man in Bibliothekskatalogen[1] zwar Bücher, nicht aber Zeitschriftenartikel verzeichnet finden. Weiters existieren zumindest auf den größeren Bibliotheken zumeist mehrere Kataloge neben einander (z.B. Nominalkatalog, Schlagwortkatalog, Institutskataloge, Zeitschriftenkatalog). Für ältere Literatur ist zu beachten, dass diese meist nicht in den Onlinekatalogen zu finden ist, sondern speziell in den Zettelkatalogen (die manchmal eingescannt auch online zugänglich sind) zu suchen ist. In den Zeitschriftenkatalogen[2] ist nur verzeichnet, welche Zeitschriftenbestände es in der jeweiligen Bibliothek gibt, nicht aber, der Inhalt der Zeitschriften, sprich welche Artikel zu welchem Thema in der jeweiligen Ausgabe der Zeitschrift publiziert wurden. Um gezielt nach Zeitschriftenartikeln zu suchen, können aber unterschiedliche Zeitschriftendatenbanken[3] konsultiert werden. Weiters existieren noch Metasuchmaschinen[4], die einen gleichzeitigen Zugriff auf unterschiedliche Kataloge bieten, sowie unterschiedliche darüber hinausgehende Internetressourcen[5].
Die virtuelle Fachbibliothek Ethnologie (Evifa) bietet auch einen Recherchekurs[6] im Fachbereich der Ethnologie an.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 3.1.2.1
[2] Siehe Kapitel 3.1.2.3
[3] Siehe Kapitel 3.1.2.4
[4] Siehe Kapitel 3.1.2.2
[5] Siehe Kapitel 3.1.2.5
[6] http://lotse.uni-muenster.de/ethnologie_volkskunde/index-de.php
3.1.2.1 zentrale Bibliothekskataloge
Zu den wichtigsten Wiener Bibliotheken für Kultur- und Sozialanthropologen gehören:
- Fachbibliothek des Instituts für Kultur- und Sozialanthropologie[1]
- Bibliothek des Museums für Völkerkunde[2]
Neben diesen beiden spezialisierten Fachbibliotheken existieren eine Reihe weiterer Bibliotheken, die zentrale Ressourcen für Kultur- und Sozialanthropologen bereitstellen. Dazu gehören unter anderen:
- Universitätsbibliothek Wien (UBW)[3]
- Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB)[4]
- Bibliothek der Österreichischen Akademie der Wissenschaften[5]
- Bibliothek der österreichischen Arbeiterkammer[6]
Für den Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit ist darüber hinaus noch die Bibliothek der österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung (ÖFSE)[7] sowie für den Bereich der Ethnomedizin bzw. der Medical Anthropology die Bibliothek des Instituts für Geschichte der Medizin[8] zu nennen.
Die meisten dieser Bibliotheken haben eigene Onlinekataloge. Dies gilt allerdings nicht für die Bibliothek des Museums für Völkerkunde, wo ein Onlinekatalog erst im Aufbau ist und man sich deshalb nur vor Ort einen Überblick über den Bestand der Bibliothek verschaffen kann. Die Bestände des Museums gehen in vielen Bereichen über den der Institutsbibliothek hinaus.
Diese Onlinekataloge sind einerseits in virtuellen Gesamtkatalogen zusammengefasst, andererseits sind die älteren Bestände oft nicht oder nur über spezielle eingescannte Zettelkataloge abrufbar (z.B. Zettelkatalog der Universität Wien[9]). Der Onlinekatalog der Universitätsbibliothek Wien[10] umfasst auch die Kataloge aller Fachbereichsbibliotheken (Liste aller Fachbereichsbibliotheken[11]).
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit auf e-books zuzugreifen, dies ist an der Universität Wien entweder über einen PC vom Campus aus, oder von zu Hause aus über UniVPN[12] möglich.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://bibliothek.univie.ac.at/fb-kultur_sozialanthropologie/
[2] http://www.khm.at/mvk/bibliothek/
[3] http://bibliothek.univie.ac.at/
[4] http://www.onb.ac.at/
[5] http://www.oeaw.ac.at/biblio/
[6] http://wien.arbeiterkammer.at/online/page.php?P=599&URL=www-1523.html
[7] http://www.oefse.at/bibliothek.htm
[8] http://www.meduniwien.ac.at/histmed/bibliothek_lang.htm
[9] http://bibliothek.univie.ac.at/hauptbibliothek/kataloge_hauptbibliothek.html
[10] http://aleph.univie.ac.at
[11] http://aleph.univie.ac.at
[12] http://www.univie.ac.at/ZID/vpn/
3.1.2.2 Verbundkataloge und Metasuchmaschinen
Der zentrale Verbundkatalog österreichischer Bibliotheken[1] inkludiert Bestände von Wiener Bibliotheken[2] und Bibliotheken in den Bundesländern[3]. In diesem Verbundkatalog existiert auch ein eigener Teilkatalog für Zeitschriften und Serien[4], die in österreichischen Bibliotheken geführt werden.
Ein weit umfassenderer und internationaler Verbundkatalog ist der Karlsruher Virtuelle Katalog[5] (KVK). Hier kann gleichzeitig in Bibliotheken und Verbundkatalogen aus ganz Europa und den Vereinigten Staaten nach Literatur gesucht werden. Neben diesen Verbundkatalogen existieren noch weitere Metasuchmaschinen, von denen hier nur drei genannt werden sollen.
Die Virtuelle Fachbibliothek Ethnologie[6] (EVIFA), ein Internetportal für ethnologische und volkskundliche Fachinformation. Hier kann nicht nur nach Literatur gesucht werden, sondern es gibt auch Verweise auf geprüfte Onlinequellen (Ethno-Guide) und auf einschlägige E-Journals[7].
Eine weitere regional ausgerichtete virtuelle Fachbibliothek für Ibero-Amerika, Spanien und Portugal ist Cibera[8].
Einen Zusammenschluss österreichischer Bibliotheken aus dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit stellt der Verbundkatalog EZA[9] dar.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://meteor.bibvb.ac.at/F?func=file&file_name=start&local_base=acc01
[2] http://www.obvsg.at/kataloge/kataloge-wien/
[3] http://www.obvsg.at/kataloge/kataloge-bundeslaender/
[4] http://meteor.bibvb.ac.at/F?func=file&file_name=start&local_base=acczs
[5] http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
[6] http://www.evifa.de/cms/de/
[7] http://bibliothek.univie.ac.at/zeitschriftensuche.html
[8] http://www.cibera.de/de/
[9] http://www.eza.at/index1.php?menuid=175
3.1.2.3 Zeitschriftenkataloge
Zeitschriftenkataloge erlauben eine Suche nach dem Zeitschriftenbestand, jedoch keine Titelsuche in den Zeitschriften selbst. Jeder Bibliothekskatalog verfügt im Normalfall über einen separaten Zeitschriftenkatalog, der die an der Bibliothek aufliegenden Periodika auflistet (z.B. Zeitschriftenkatalog der Universität Wien[1])
Auch für Zeitschriftenkataloge wurden virtuelle Verbundkataloge geschaffen. Zu den wichtigsten gehören der Österreichischer Teilkatalog Zeitschriften und Serien[2] und für Deutschland die Deutsche Zeitschriftendatenbank (ZDB[3]). Über die ZDB können auch einzelne Zeitschriftenartikel vergleichsweise preiswert durch verschiedene Lieferservices wie etwa Subito[4], oder BVB[5], bestellt werden.
Diese Zeitschriftendatenbanken enthalten nicht nur Printwerke, sondern auch Titel elektronischer Zeitschriften sind verzeichnet. Ein eigenes Verzeichnis elektronischer Zeitschriften ist die Elektronischer Zeitschriftenbibliothek[6] (EZB). Von all den elektronischen Zeitschriften, die hier aufgelistet sind, sind grün markierte Zeitschriften direkt zugänglich. Gelb markierte sind jene, für die die jeweilige Bibliothek Zugangsrechte erworben hat und die im Fall der Universität Wien von PC am Campus oder über webVPN[7] von zu Hause aus zugänglich sind. Die rot markierten Zeitschriften sind nicht frei zugänglich. Eine andere Art der Aufstellung elektronischer Zeitschriften, für welche die Universitätsbibliothek Wien Zugangsrechte besitzt, bietet der SFX[8].
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://aleph.univie.ac.at/F/Y8B2LEEJE69XJXRKU8CHVKC417RUAS6D64GJ9LMJ2QPH24PACA-03858?func=file&file_name=start-find-APER&local_base=APER
[2] http://meteor.bibvb.ac.at/F?func=file&file_name=start&local_base=acczs
[3] http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/
[4] http://www.subito-doc.de/index.php?lang=de&mod=page&pid=Dokumentlieferung
[5] http://www.bib-bvb.de/
[6] http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UBWI
[7] Siehe Kapitel
[8] http://sfx.univie.ac.at:9003/sfx_local/az/
3.1.2.4 Zeitschriftendatenbanken
Mittels Zeitschriftendatenbanken bekommt man Zugriff auf Abstracts von Zeitschriftenartikeln oder Zeitschriftenvolltexte. Innerhalb der Datenbanken ist eine Suche nach z.B. Schlagwörtern oder Autoren möglich. Durch die Eingabe der Suchbegriffe bekommt man eine Trefferliste, die genaue bibliographische Angaben liefern.
Die Universität Wien verfügt mittlerweile über ein reichhaltiges Datenbankservice[1], welches für Studierende über ihren Unet-Account zugänglich ist. Auf etliche dieser Datenbanken hat man nur vom Campus aus bzw. mittels UniVPN[2] auch von zu Hause aus Zugriff (siehe Zugriffsbedingungen[3]).
Zu den wichtigsten Datenbanken, auf die über die Universität Wien Zugriff besteht, gehören:
- JSTOR / Arts & Sciences I, II, III
Die JSTOR Datenbanken beinhalten Volltexte der jeweiligen Zeitschriften, die in der Datenbank aufgenommen sind, darunter fallen die wichtigsten kultur- und sozialanthropologische Zeitschriften wie Current Anthropology, American Anthropologist, Annual Review of Anthropology, The Journal of the Royal Anthropological Institute, etc.
- Anthropological Literature on Disc
- Ethnologie
- ISI Web of Science
- Hispanic American Periodicals Index - HAPI Online (ab 1970)
HAPI-Online ist die WWW-Version des "Hispanic American Periodicals Index": "HAPI is source for authoritative, worldwide information about Central and South America, Mexico, the Caribbean basin, ...
- Sociological Abstracts (CSA) SFX-fähig
- PCI Periodical Contents Index Online
- Anthropological Index Online
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel
[2] http://www.univie.ac.at/ZID/vpn/
[3] http://data.univie.ac.at/dbs/help_inhalt.html
3.1.2.5 andere Internetressourcen
Mit Google Scholar[1] kann man eine allgemeine Suche nach wissenschaftlicher Literatur durchführen.
German Anthropology Online[2] stellt unterschiedliche Informationen und Literaturhinweise für die deutschsprachige Kultur- und Sozialanthropologie zur Verfügung.
Anthrosource[3] bietet die Möglichkeit einer AutorInnen- und Schlagwortsuche in verschiedenen anthropologischen Zeitschriften der American Anthropological Association.
Der Anthropological Index Online[4] des Royal Anthropological Institute erlaubt ebenfalls eine Suche nach Schlagworten und AutorInnen in unterschiedlichsten kultur- und sozialanthropologischen Fachzeitschriften.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://scholar.google.de/
[2] http://www.anthropology-online.de/index.html
[3] http://www.anthrosource.net/Default.aspx
[4] http://aio.anthropology.org.uk/aiosearch/
3.2 Von der Fragestellung zum Forschungskonzept
Mit der Themenfindung und der Erarbeitung konkreter Fragestellungen ist die Arbeit im Vorfeld der konkreten Forschungsaktivitäten jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Vielmehr gehört das darüber hinaus gehende Erstellen von Forschungskonzepten bzw. Forschungsanträgen zu den zentralen Tätigkeiten im Vorfeld eines jeden strukturierten Forschungsvorhabens.
Forschungskonzepte haben drei zentrale Funktionen:
1) Sie verankern das eigene Forschungsvorhaben im vorliegenden Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse.
2) Sie legen fest, was man wie, wo, mit welchen Mitteln und in welchem Zeitraum zur Beantwortung bestimmter Forschungsfragen zu tun gedenkt. D.h. in Forschungskonzepten kommen die Planung und Strukturierung der zukünftigen Forschungsaktivitäten zum Ausdruck.
3) Solche Konzepte dienen aber nicht nur der Planung und Strukturierung zukünftiger Aktivitäten im Sinne einer Selbstfestlegung, sondern sie müssen zumeist anderen vorgelegt werden, die darüber entscheiden, ob die Forschung in dieser Art und Weise durchgeführt werden soll. Damit ist man bereits als Studierende/r konfrontiert, wenn man Konzepte für Seminar-, Bachelor- oder Diplomarbeiten den LehrveranstaltungsleiterInnen bzw. den BetreuerInnen der Abschlussarbeiten vorlegen muss. In umfangreicherer und ausführlicherer Art und Weise handelt es sich aber bei jedem Projektantrag, mit dem um Finanzierung von Forschungsvorhaben angesucht wird, um ausgearbeitete Forschungskonzepte, welche dann von FachkollegInnen begutachtet und evaluiert werden. Auf Basis dieser Begutachtung entscheiden Förderorganisationen ob ein Projekt finanziert wird.
Welche genaueren Inhalte sind nun allgemeiner Teil solcher Forschungskonzepte?
3.2.1 Zentrale Inhalte von Forschungskonzepten
Ziele, Fragestellungen und deren theoretische Einbettung.
Ein Forschungskonzept muss Angaben zu den Zielen und den konkreten Fragestellungen[1] der geplanten Untersuchung beinhalten. Diese müssen darüber hinaus im aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand verankert werden. Dazu ist es notwendig, sich ein Bild über den aktuellen Forschungsstand zu erarbeiten und zu zeigen, wie das eigene Vorhaben an diesen anschließt und in welchen Bereichen es über diesen hinausgeht, d.h. wissenschaftliches Neuland betritt.
Weiters beinhalten Forschungskonzepte detaillierte Angaben darüber, welche methodischen Vorgehensweisen für die Datenerhebung[2] und Datenanalyse[3] eingesetzt werden und wie diese in einen geplanten Forschungsablauf[4] eingebettet sind.
Ebenso gehören Angaben über die benötigten Ressourcen zu den notwendigen Informationen die im Forschungskonzept enthalten sein müssen. Dazu gehören Angaben
- zum zeitlichen Ablauf und der Dauer einzelner Arbeitsschritte, etwa in Form von Gantt-Diagrammen[5],
- zur Anzahl und notwendigen Qualifikation eventueller MitarbeiterInnen oder AssistentInnen,
- zur notwendigen Infrastruktur und den notwendigen Sachmitteln (Geräte, Forschungsmaterialien, etc.) um das Projekt durchführen zu können;
- In diesem Zusammenhang sind auch Anbindungen an bestehende Institutionen bzw. Institute in deren Rahmen die Forschung durchgeführt wird zu nennen, aber auch darüber hinaus gehende Kooperationen mit anderen wissenschaftlichen Institutionen und ForscherInnen.
Schlussendlich müssen die benötigten zeitlichen, personellen und infrastrukurellen Ressourcen in einen Finanzplan Eingang finden, der die Kosten für die Durchführung des Projektes benötigten Ressourcen (Arbeitszeit, MitarbeiterInnen, Sachmittel) auflistet.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 3.1
[2] Siehe Kapitel 4.1
[3] Siehe Kapitel 6
[4] Siehe Kapitel 4
[5] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/schreiben/schreiben-13.html
3.3 Kontexte eines Forschungsprojekts
In der Methodenliteratur werden oft unterschiedliche Kontexte bzw. Zusammenhänge, in die Forschungsprojekte[1] eingebettet sind, benannt. Dazu gehören die Unterscheidung von Entdeckungszusammenhang und Begründungszusammenhang, die auf Hans Reichenbach[2] (1891- 1953) zurück geht und später durch den Verwertungszusammenhang wissenschaftlicher Forschung ergänzt wurde. Diese drei Ebenen können in loser Anlehnung an die ursprüngliche wissenschaftstheoretische Diskussion wie folgt verstanden werden:
Unter Entdeckungszusammenhang versteht man den Anlass für ein Forschungsprojekt. Dabei können jenseits eines allgemeinen Interesses drei zentrale Anlässe unterschieden werden. Ausgangspunkte für Forschung können somit
- empirische Probleme sein, die der/die ForscherIn identifiziert und bearbeiten möchte,
- offene theoretische Probleme sein, die sich aus vorliegenden Untersuchungen ergeben,
- oder Probleme sein, die von dritter Seite, nämlich von Auftraggebern formuliert werden.
Unter Begründungszusammenhang werden jene methodischen Schritte und Verfahren verstanden, mit deren Hilfe ein Problem untersucht werden soll. Dazu gehören auch Aussagen über den Forschungsablauf und ob und in wie weit von vorhandenen Theorien und expliziten Hypothesen ausgegangen wird oder ob solche erst im Zuge des Projektes entwickelt werden sollen.
Unter Verwertungs- bzw. Wirkungszusammenhang von Forschung versteht man die Effekte von Forschungsaktivitäten. Darunter fällt der Beitrag zur Lösung empirischer, theoretischer oder bei angewandter Forschung praktischer Probleme. Dazu gehören auch Überlegungen über die Art und Weise der Verbreitung und des Zugänglichmachens der Ergebnisse. Effekte von Forschung können sich aber auch auf nicht intendierte und potentiell negative Auswirkungen für die Beforschten und die breitere Gesellschaft beziehen. Die Frage des Verwertungs- bzw. Wirkungszusammenhangs von Forschung steht somit in engem Zusammenhang mit der Ethik der Forschung.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-1.html
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Reichenbach
3.3.1 Ethik der Forschung
Probleme von Ethik in der Forschung sind im Normalfall aus dem Bereich der Medizin oder Gentechnologie bekannt. Dabei stellen sich in der Medizin Fragen wie z.B. "Wann beginnt schützenswertes Leben?" oder "Welche Rolle spielte die Medizin im Nationalsozialismus?". In der Gentechnik werden Themen wie das Patentieren und Freisetzen genetisch manipulierter Pflanzen, die Produktion transgener Lebewesen oder auch die Stammzellenforschung diskutiert.
Es stellt sich aber auch innerhalb der Sozialwissenschaften die Frage nach der Ethik und den legitimen Grenzen des professionellen Handelns als SozialforscherIn auf mehreren Ebenen:
- gegenüber den Untersuchten
- im Umgang mit den Forschungsergebnissen
- gegenüber der wissenschaftlichen Gemeinschaft
- gegenüber der Öffentlichkeit
- gegenüber Sponsoren, Geld- und Arbeitsgebern
- gegenüber Regierungen
Bis heute existieren keine einheitlichen und weltweit anerkannten ethischen Standards in Bezug auf das professionelle Handeln als Kultur- und SozialanthropologIn.
Richtlinien zur Forschungsethik wurden vielmehr auf der Ebene professioneller Vereine und Interessensvertretungen formuliert und finden sich etwa auf den Homepages folgender anthropologischer Gesellschaften:
- der American Anthropological Association[1],
- der Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth[2],
- der World Council of Anthropological Associations[3]
- oder der International Society of Ethnobiology[4].
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.aaanet.org/committees/ethics/ethics.htm
[2] http://www.%20theasa.org/ethics/guidelines.htm
[3] http://www.wcaanet.org/page/54rg/page/54
[4] http://ise.arts.ubc.ca/global_coalition/ethics.php
3.3.1.1 Ethik gegenüber den Untersuchten
Die Ethik gegenüber den Untersuchten umfasst unterschiedliche Bereiche. Als Minimalstandard gilt es unsere InformantInnen und die Untersuchten vor Schaden zu bewahren. Dies impliziert den Schutz ihrer Persönlichkeit und Privatheit, dass sie durch die Forschung keinen Nachteilen oder Gefahren ausgesetzt werden und im Vorfeld über mögliche Risiken aufgeklärt werden. Zur Ethik gegenüber den Untersuchten gehört auch eine gerechte Entlohnung für Arbeiten die sie innerhalb von Forschungsprojekten erbringen.
Der Schutz der InformantInnen vor negativen Folgen ist insbesondere auch bei der Weitergabe und Veröffentlichung der Daten zu berücksichtigen. Dies impliziert in potentiell problematischen Bereichen Anonymität zu gewährleisten. Andererseits kann es bedeuten, dass die Urheber von Wissen und Techniken explizit genannt werden müssen, um zukünftige Rechtsansprüche auf dieses Wissen und diese Techniken geltend machen zu können.
Ein weiter gefasstes Ethikverständnis, welches über den reinen Schutz der InformantInnen hinausgeht, basiert auf dem Konzept der informierten Zustimmung (informed consent). Dieses setzt Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber InformantInnen über Zielsetzungen, Methoden und mögliche Verwertungszusammenhänge der Ergebnisse der Untersuchung voraus. Auf Basis dieser expliziten Informationen sollen die Untersuchten frei entscheiden, ob und wie sie an einer Untersuchung teilnehmen wollen.
Die Prinzipien der Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber InformantInnen schließen praktisch bestimmte methodische Vorgehensweisen aus, insbesondere verdeckte Beobachtung[1] und verdeckte Experimente. In der Praxis existiert hier eine Grauzone, da das Prinzip der informierten Einwilligung nicht immer vollständig umgesetzt werden kann und je nach Situation und Projekt vom einzelnen Forscher entschieden werden muss, ob der Einsatz bestimmter methodischer Verfahren ethisch vertretbar ist.
Ein noch weiter gefasstes Verständnis partizipativer Forschung geht über das Kriterium der informierten Zustimmung insofern hinaus, als Forschungsanliegen und die Form der Umsetzung der Forschung mit den Betroffenen selbst in einem partizipativen Prozess entwickelt werden.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-28.html
3.3.1.2 Ethik im Umgang mit Ergebnissen
Ein zentrales ethisches Problem ist der Umgang mit den im Zuge von Forschungen erhobenen Daten und Ergebnissen. Dabei gilt es unterschiedliche, zum Teil konkurrierende ethische Prinzipien zu beachten. Einerseits ist im Sinne des Schutzes der Persönlichkeit und Privatheit der InformantInnen die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten. Andererseits ist sowohl den Untersuchten, den FachkollegInnen, den AuftraggeberInnen, als auch einer breiten Öffentlichkeit das Recht auf Zugang zu den Forschungsergebnissen zu gewähren. Im Zentrum der Ethik im Umgang mit den Ergebnissen steht also die Herausforderung gleichzeitig die Persönlichkeit und Privatheit der InformantInnen zu schützen und einen Zugang zu den Forschungsergebnissen zu gewähren.
Um die Persönlichkeit und Privatheit der InformantInnen zu schützen, können unterschiedliche Arten und Ausmaße der Anonymisierung von Informationen eingesetzt werden. Dies ist insbesondere bei der Publikation von Forschungsergebnissen zu berücksichtigen, kann aber auch bereits auf der Ebene der Rohdaten von zentraler Wichtigkeit sein. Hierbei spielt das fehlende Recht zur Aussageverweigerung von SozialwissenschaftlerInnen eine zentrale Rolle. Im Gegensatz zu anderen Berufsgruppen, wie Ärzten oder Priestern können sich SozialwissenschaftlerInnen selbst in Europa auf kein Aussageverweigerungsrecht zum Schutz ihrer InformantInnen berufen. Das heißt, bei rechtlichen Schwierigkeiten der InformantInnen bzw. wenn diese auf Grund von Verdächtigungen Gegenstand polizeilicher bzw. staatlicher Ermittlungen werden, kann eventuell auch auf die von SozialwissenschaftlerInnen gesammelten Daten zugegriffen werden. Bei einer Weigerung diese zur Verfügung zu stellen, kann man in manchen Ländern auch der Mittäterschaft bzw. Verhinderung der Aufklärung eines Verbrechens beschuldigt werden. Diesbezügliche Zugriffs- und Durchgriffsrechte wurden im Zuge der aktuellen Bestrebungen vieler Regierungen zur Terrorismusbekämpfung weiter ausgebaut.
Deshalb kann es sinnvoll sein, bereits auf der Ebene der Rohdaten Techniken zu entwickeln, die es unmöglich machen die Identität von Personen mit bestimmten Informationen in Zusammenhang zu bringen. Dazu kann das Löschen der individuellen Identifizierungsmerkmale, wie Name, Adresse, Wohnort oder die separate Abspeicherung dieser Daten gehören.
Oft werden bei ethnographischer Forschung aber auch Formen traditionellen Wissens und traditioneller Technologien dokumentiert und verschriftlicht, die in weiterer Folge Gegenstand ökonomischer Verwertungsinteressen werden. Dies ist insbesondere im Bereich der Ethnomedizin, der Ethnopharmakologie aber auch Ethnobiologie der Fall, wo zum Teil Konzerne systematisches bio-prospecting auch bei und mit indigenen Gruppen betreiben. Um auch im Zuge der existierenden rechtlichen Rahmenbedingungen, wie der indigenous knowledge rights, die Ansprüche der Urheber dieses Wissens festzuschreiben, ist es notwendig Informanten, Gemeinschaften und indigene Gruppen als Urheber dieses Wissens explizit zu benennen.
3.3.1.3 Ethik gegenüber der wissenschaftlichen Gemeinschaft
Ethische Probleme bestehen aber nicht nur im Umgang mit den InformantInnen und den erhobenen Daten, sondern auch gegenüber der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Zu den zentralen ethischen Prinzipien gegenüber der wissenschaftlichen Gemeinschaft gehören:
- die bestmögliche wissenschaftliche Integrität und Objektivität,
- die Einhaltung bestmöglicher und aktueller wissenschaftlicher Standards,
- die Veröffentlichung der Resultate ohne Auslassung wichtiger Ergebnisse,
- die transparente Darstellung der Methode und des Forschungsdesigns,
- das Explizitmachen der Finanzierungsquelle bzw. des Auftragsgebers,
- das öffentlich zugängig machen der Forschungsergebnisse in geeigneter Weise,
- das Kenntlichmachen von Erkenntnissen und Daten Dritter in geeigneter Weise unter Angabe der ursprünglichen Quellen, also die Vermeidung von Plagiaten[1].
Dadurch sollte jede/r WissenschafterIn zur Reputation seiner /ihrer Disziplin beitragen. Für die Kultur- und Sozialanthropologie gilt dies insbesondere auch für das Verhalten im Feld und den Umgang mit den Beforschten um zukünftige Forschungen nicht zu gefährden. Dazu kann bei internationalen Forschungsprojekten auch gehören, lokale AnthropologInnen in die Projekte miteinzubinden, Daten mit KollegInnen auszutauschen und Forschungsergebnisse auch in jenen Ländern zugänglich zu machen, in denen die Forschung statt gefunden hat.
Bei interdisziplinären Forschungsprojekten sind Kultur- und Sozialanthropologen auch dazu angehalten, ihre eigenen ethischen Standards offen zu legen und klar zu machen und eine entsprechende Klärung der Rollen, Rechte und Pflichten im Zuge des Projektes vorzunehmen. ProjektleiterInnen und BetreuerInnen wissenschaftlicher Arbeiten haben auch darauf zu achten, dass MitarbeiterInnen und Studierende die ethischen Richtlinien der Disziplin kennen und eventuell auftretende Probleme im Zuge des Projekts offen diskutiert werden.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/schreiben/schreiben-62.html
3.3.1.4 Ethik gegenüber der Öffentlichkeit
AnthropologInnen haben auch eine ethische Verantwortung gegenüber der breiteren Öffentlichkeit. Dazu gehören
- die Wahrung der professionellen Integrität in Forschung und Lehre,
- die Berücksichtigung widersprüchlicher sozialer Interessen
- und ein allgemeines Interesse am Ausbau der Reichweite und der Relevanz von anthropologischer Forschung, welcher auch ein Bewusstsein der Notwendigkeit und Relevanz kultur- und sozialanthropologischer Forschung in der breiteren Bevölkerung einerseits voraussetzt, andererseits zu schärfen hat.
Zur Wahrung der professionellen Integrität gehört das Ziel möglichst unverzerrte Forschungsergebnisse zu produzierten und zu kommunizieren. Die Auswahl der Datenerhebungs- und Interpretationsmethoden sowie die Darstellung der Ergebnisse haben diesem Prinzip zu folgen. Gleichzeitig sollen die Grenzen der Reichweite der Aussagen[1] die auf Basis dieser Verfahren gewonnen wurden möglichst explizit gemacht werden.
Die Berücksichtigung widersprüchlicher sozialer Interessen findet vor dem Hintergrund der allgemeinen Überzeugung statt, dass qualitätsvolle Information über sozio-kulturelle Phänomene und Prozesse für die Entwicklung, Entscheidungsfindung und Interessen der Gesellschaft hilfreich und nicht gefährdend sind. Dennoch müssen die möglichen Konsequenzen von Forschungsergebnissen für die breitere Gesellschaft, spezifische gesellschaftliche Gruppen sowie die untersuchten Personen bedacht werden und können in der Art und Weise der Kommunikation der Ergebnisse berücksichtigt werden.
Forschungsergebnisse können immer auch von Dritten missbräuchlich verwendet werden. ForscherInnen sind oft nicht in der Lage eine solche missbräuchliche Verwendung ihrer Forschungsergebnisse zu verhindern. Sie sollten aber soweit vorhersehbar solchen missbräuchlichen Interpretationen bereits in der Interpretation und Art und Weise der Kommunikation der Ergebnisse entgegentreten und sie sind aufgefordert explizit Stellung zu beziehen, wenn solche dennoch vorgenommen werden.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/ksamethoden/ksamethoden-40.html
3.3.1.5 Ethik gegenüber Sponsoren, Geld- und Arbeitsgebern
Zu den Aufgaben der Kultur- und SozialanthropologInnen gehört es, die jeweiligen Verpflichtungen gegenüber den in unterschiedlichen Rollen am Projekt beteiligten Personen und Institutionen abzuklären. Dazu gehören die Verpflichtungen gegenüber den Sponsoren, Geld- und ArbeitgeberInnen genauso, wie jene gegenüber den Beforschten und der wissenschaftlichen Kollegenschaft.
Dabei ist es wichtig, insbesondere gegenüber Geld- und ArbeitgeberInnen bereits vor Beginn des Projektes Rollen, Rechte und Pflichten abzuklären. Es ist darauf zu achten, dass Konditionen ausgehandelt werden, welche ein Arbeiten nach ethischen Grundsätzen ermöglichen und nicht Bedingungen zugestimmt wird, welche diese Grundsätze explizit oder implizit in Frage stellen.
Ebenso ist zu beachten, dass es zu potentiellen Interessenskonflikten zwischen den Auftrags- bzw. ArbeitgeberInnen und den untersuchten Personen kommen kann. Man sollte sich im Rahmen der Forschung die Möglichkeit bewahren, die Rechte und Interessen der Beforschten zu schützen und eigenständig die ethischen Entscheidungen zu fällen. Dies betrifft auch die Rechte auf die gesammelten Daten, auf Publikationen, Urheberrechte und Tantiemen.
Insgesamt sollten die ForscherInnen, die auf dieser Grundlage eingegangenen allgemeinen und spezifischen Verpflichtungen gegenüber Geld- und ArbeitgeberInnen einhalten. Dazu gehört insbesondere auch die wahrheitsgemäße Auskunft über eigene Qualifikationen, eventuelle Einschränkungen, sowie Vor- und Nachteile der verwendeten Methoden und erwartbaren Daten, aber auch der vertrauliche Umgang mit Informationen, die von Geld- oder ArbeitgeberInnen zur Verfügung gestellt wurden. Man sollte sich als ForscherIn Einblick in die Geldquellen, das Personal und die Ziele der Institutionen verschaffen, die das jeweilige Forschungsprojekt finanzieren.
Informationen, die eine erfolgreiche Durchführung des Projektes in Frage stellen, sollten nicht verheimlicht werden.
Gleichzeitig kann man von Geld- und ArbeitgeberInnen erwarten, dass sie die persönlichen Qualifikationen des/der ForscherIn und die Rechtschaffenheit der Daten respektieren und dass die eingesetzten Methoden, öffentlich gemacht werden können.
Die ethisch relevanten Rechte, die man sich als ForscherIn gegenüber Geld- und AuftraggeberInnen vorbehält, sollten auch nicht an Dritte, z.B. nationale Institutionen und Kooperationspartner in Drittländern, übergehen. Vielmehr sollten projektrelevante Verhandlungen direkt mit den Betroffenen geführt werden.
3.3.1.6 Ethik gegenüber Regierungen
AnthropologInnen sollten auch aufrichtig gegenüber der eigenen und anderen Regierungen sein und sich versichern, dass sie nicht genötigt werden ihre professionellen Standards und Verantwortlichkeiten aufzugeben, um Forschungsgenehmigungen zu erhalten. Gleichzeitig sollten sie im dem Bewusstsein handeln, dass unverantwortliche Aktionen und Tätigkeiten im Feld den Zugang zu gewissen Forschungsregionen oder ganzen Ländern für andere ForscherInnen in Frage stellen können. Gleichzeitig hat man als AnthroplogIn die Verantwortung seine Rolle nicht als Deckmantel für geheime Forschungen oder Aktivitäten zu verwenden.
Forschungen in anderen Staaten haben die jeweiligen rechtlichen und administrativen Regelungen zur Durchführung von Datenerhebungen zu beachten.
3.3.1.7 The War against Terror und das Human Terrain System
Ethische Probleme, insbesondere der Einsatz von Kultur- und SozialanthropologInnen im Dienste von Regierungen und im Kontext kriegerischer Auseinandersetzungen, wurden in jüngster Vergangenheit an Hand des so genannten Human Terrain System des US-amerikanischen Militärs in der breiten Öffentlichkeit (siehe z.B. folgenden Beitrag[1] auf der ersten Seite der New York Times), wie innerhalb der Kultur- und SozialanthropologInnen heftig diskutiert.
- Ausgabe von Anthropology Today. VIRTUAL ISSUE: War on Terror 2008 - Vol.24[2]
- Human Terrain System (HTS) Project[3]
- AAA Report (pdf)[4]
- AAA - Anthropolgy and the Military[5]
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.nytimes.com/2007/10/05/world/asia/05afghan.html
[2] http://sinagbayan.multiply.com/journal/item/155/Anthropology_Today_Issue_War_on_Terror_Virtual_
[3] http://www.aaanet.org/about/Policies/statements/Human-Terrain-System-Statement.cfm
[4] http://www.aaanet.org/_cs_upload/pdf/4092_1.pdf
[5] http://www.aaanet.org/issues/policy-advocacy/Anthropolgy-and-the-Military.cfm
3.4 Literatur
Blumer, Martin - "Ethik in der Sozialforschung". Kuper-Enzyklopädie: . 258f
Hopf, Christel (2000): Forschungsethik und qualitative Forschung. In: Flick, Uwe; Kardaroff, Ernst von; Steinke, Ines (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbeck b. H.: Rowohlt: S. 589-600.
Kuster, Jürg; Huber, Eugen; Lippmann, Robert; Schmid, Alphons; Schneider, Emil; Witschi, Urs; Wüst, Roger (2006): Handbuch Projektmanagement. Springer: Berlin [u.a.].
Patzak, Gerold; Rattay, Günter (2004): Projektmanagement. Linde: Wien.
4 Forschungsablauf
Innerhalb der empirischen Sozialforschung können idealtypisch zwei Formen des Ablaufs von Forschungsprojekten unterschieden werden. Einerseits die lineare, primär quantitative Vorgehensweise, andererseits die zirkuläre, hauptsächlich innerhalb der qualitativen Sozialforschung zum Einsatz kommende Strategie. Diese beiden Strategien wurden von Witt wie folgt veranschaulicht:
Abbildung: Linearer und zirkulärer ForschungsablaufAbbildung: Linearer und zirkulärer Forschungsablauf
(Quelle: http://www.qualitative-research.net/fqs- texte/...)
Diese beiden Forschungsabläufe unterscheiden sich in vielfacher Hinsicht.
Bereits Ausgangspunkt und Zielsetzung stellen sich unterschiedlich dar. In der linearen Vorgangsweise geht man von existierenden Theorien aus, formuliert vor deren Hintergrund explizite Hypothesen, welche im Zuge der Forschung getestet werden. Ziel ist also das Prüfen bzw. Testen von Theorien. Empirische Ergebnisse, die den zugrunde gelegten Theorien und Hypothesen widersprechen, werden zum Anlass genommen, diese zu adaptieren und weiter zu entwickeln.
Bei der zirkulären Vorgangsweise steht hingegen ein vergleichsweise vages Vorverständnis des Feldes bzw. des Phänomens am Beginn der Forschung, welches im Zuge des Forschungsprozesses systematisch verfeinert und vertieft wird und schließlich zur Formulierung von allgemeineren Aussagen in Form von Theorien und Hypothesen führt. Primäres Ziel dieser Forschungsstrategie ist also die Theorieentwicklung und nicht die systematische Überprüfung existierender Theorien oder im Vorfeld formulierter Hypothesen.
In der Methodenliteratur wird zumeist qualitative Forschung mit Theorieentwicklung und quantitative mit Theorieprüfung in Zusammenhang gebracht. Tatsächlich ist es aber so, dass durchaus auch qualitative ethnographische Forschung dazu eingesetzt werden kann, existierende Theorien zu kritisieren, zu verwerfen oder gegebenen Falls zu erweitern. So kann etwa aus einer im Zuge eines Forschungsprojektes entwickelten Theorie auf Mängel, Unzulänglichkeiten oder falsche Annahmen bereits existierender Theorien geschlossen werden.
Ebenso wird in der quantitativen Sozialforschung nicht immer von explizit im Vorfeld formulierten Theorien und Hypothesen ausgegangen. Vielmehr werden in der Forschungspraxis erhobene Datensätze oft auf signifikante Zusammenhänge hin untersucht und erst nachträglich Hypothesen und Theorien formuliert, die statistische Zusammenhänge erklären.
Dies zeigt, dass die beiden skizzierten Forschungsabläufe nur bedingt einzelnen
Formen des Schlussfolgerns[1] zugeordnet werden können. Auch wenn eine lineare theorieprüfende Vorgangsweise vom Ansatz her deduktiv[2] vorgeht, gibt es in diesen Projekten induktive[3] Formen des Schlussfolgerns, wo aus den Daten auf neue bzw. alternative Hypothesen und Theorien geschlossen wird. Im Gegensatz dazu geht die zirkuläre Vorgangsweise von ihrem Ansatz her induktiv vor und versucht Theorien und Hypothesen aus dem empirischen Material zu entwickeln. Dies tut sie in der Forschungspraxis aber im Rahmen eines zirkulären bzw. iterativen Prozesses, der permanent aus dem empirischen Material Annahmen und Hypothesen generiert, die im Zuge der weiteren Forschung überprüft und weiterentwickelt werden. Es handelt sich also in der Praxis um eine Pendelbewegung zwischen induktivem Schließen, deduktivem Ableiten und einer empirischen Überprüfung der dabei entwickelten Annahmen.
In diesen beiden Arten des Forschungsablaufs kommen tendenziell auch unterschiedliche Arten von Daten (qualitative vs. quantitative[4]), verschiedene Samplingstrategien[5], unterschiedlich standardisierte
Erhebungsmethoden[6] und Qualitätskriterien zum Einsatz.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-4.html
[2] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-6.html
[3] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-5.html
[4] Siehe Kapitel
[5] Siehe Kapitel
[6] Siehe Kapitel
4.1 Der lineare theorie- und hypothesenprüfende Forschungsablauf
Beim linearen theorie- und hypothesenprüfenden Forschungsablauf können eine Reihe klar abgegrenzter und aufeinander folgender Phasen des Projektablaufs unterschieden werden. Dazu gehören:
- Die Problemdefinition
Die Problemdefinition sollte einerseits den Ursprung des Problems (Entdeckungszusammenhang[1]) angeben, den Phänomenbereich[2] spezifizieren und zentrale Schlüsselbegriffe definieren[3]. Andererseits können auch Ziele benannt werden. Soll das Problem im Zuge der Forschung primär beschrieben werden, sollen spezifische Hypothesen in Bezug auf das Problem getestet werden oder soll eine neue Theorie und damit ein neues Problemverständnis erarbeitet werden?
- Die Literaturrecherche
Auf Basis der Literaturrecherche[4] werden existierende Theorien und Hypothesen identifiziert, auf deren Basis gezielte Fragestellungen entwickelt werden.
- Die Hypothesenbildung
In einem nächsten Schritt erfolgt die Hypothesenbildung[5], d.h. die Festlegung der Beziehung zwischen messbaren Variablen. Dazu muss im Vorfeld eine operationale Definition[6] zentraler Begrifflichkeiten vorgenommen werden. Erst auf dieser Basis kann eine quantitativ empirische Überprüfung der Hypothesen vorgenommen werden.
- Die Festlegung der Untersuchungseinheit
Durch die Spezifizierung der Untersuchungseinheit wird festgelegt, wer (welche Personen oder Personengruppen) oder was (welche Bezirke oder Regionen) genau untersucht werden sollen. Bei der Festlegung der Untersuchungseinheit ist immer auch die Problematik des Feldzugangs zu bedenken und dahingehend zu spezifizieren, ob und in welcher Art und Weise (mit welchen Strategien und Methoden) die ausgewählten Bereiche der Untersuchung zugänglich sind.
- Die Wahl des Untersuchungsplanes
Bei der Wahl des Untersuchungsplanes geht es im Allgemeinen um das Forschungsdesign und im Besonderen um die Festlegung der spezifischen Methoden der Datenerhebung[7], die zum Einsatz kommen.
- Die Datenerhebung
In dieser Phase des Projektablaufs finden die Datenerhebung und der jeweils spezifische Kontakt mit dem untersuchten Feld statt.
- Die Datenanalyse
Nach Abschluss der Datenerhebung kommt es zur Auswertung der Daten und zur Bewertung der im Vorfeld formulierten Hypothesen.
- Schlussfolgerungen
Auf Basis der Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse wird einerseits eine Bewertung ihrer Relevanz vorgenommen, können Vergleiche zu Resultaten anderer Untersuchungen hergestellt werden und vor dem Hintergrund der erfolgten Hypothesenprüfung allgemeine Aussagen und Theorien formuliert werden. Hinweise auf offene Fragestellungen oder Probleme und Aufgaben künftiger Forschung können ebenso Teil der Schlussfolgerungen sein.
- Die Verwendung von Ergebnissen
Im Sinne des Verwertungskontextes[8] von Forschungsprojekten stellt sich die Frage der Verbreitung der Forschungsergebnisse (Publikationen, Präsentation im Internet, Teilnahme an Konferenzen, Organisation von Workshops) innerhalb und außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 3.3
[2] Siehe Kapitel 3.1.1
[3] Siehe Kapitel 2.7.1
[4] Siehe Kapitel 3.1.2
[5] Siehe Kapitel 2.7.4
[6] Siehe Kapitel 2.7.1.1
[7] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-21.html
[8] Siehe Kapitel 3.3
4.2 Der zirkuläre theorieentwickelnde Forschungsablauf
Im Gegensatz zum linearen Forschungsablauf mit klar abgegrenzten und aufeinander folgenden Phasen des Projektsablaufs steht beim zirkulären Forschungsablauf die prozessuale Integration von Datenerhebung, Analyse und Theoriebildung im Zentrum. Das heißt es wird unter anderem auf eine strikte Trennung von Datenerhebung und -analyse verzichtet. Im Normalfall wird auch nicht von Theorien und im Vorfeld formulierten Hypothesen ausgegangen, vielmehr ist die Theorie- und Hypothesengenerierung Ziel zirkulärer Forschungsprozesse.
Wer innerhalb eines solchen Forschungsprozesses genau untersucht wird, wird vor dem Hintergrund bereits gewonnener Erkenntnisse, der zunehmenden Kenntnis des Feldes und - im Sinne des theoretical samplings[1] - unter dem Gesichtspunkt, was für eine zu entwickelnde Theorie am gewinnbringendsten ist, entschieden. Dies bedeutet auch einen flexiblen Einsatz von Erhebungsmethoden. Deren Auswahl ist einerseits an der Theorieentwicklung orientiert und passt sich andererseits an die Bedingungen des Feldes an. D.h. ein im Vorfeld festgelegter Untersuchungsplan fungiert nur als Rahmen, der aber im Zuge des Forschungsprozesses, im Sinne einer impliziten Methodentriangulation[2], immer wieder neu adaptiert und an die gegebene Situation angepasst wird.
Erhobene Daten werden nicht erst nach dem Ende einer Erhebungsphase oder eines Feldaufenthaltes analysiert. Der Forschungsprozess ist vielmehr durch eine permanente Abfolge von Datenerhebungs- und Auswertungsphasen gekennzeichnet. Dies kann bedeuten, dass bereits während des Feldaufenthaltes Auswertungs- und Konzeptentwicklungsphasen eingelegt werden. Es kann aber auch bedeuten, dass man immer wieder ins Feld zurückkehrt um weitere Erhebungen durchzuführen, was von Wulff (2002) auch als Yo-yo-Feldforschung bezeichnet wurde.
Ein solcher zirkulärer Forschungsablauf kennzeichnet nicht nur die ethnographische Feldforschung sondern auch den so genannten iterativen Prozess der Theorieentwicklung im Rahmen der Grounded Theory[3].
Literatur:
Strauss, Anselm; Corbin, Juliet (1996): Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Beltz Psychologie Verlags Union, Weinheim.
Böhm, Andreas (2004) [2000]: „Theoretisches Codieren: Textanalyse in der Grounded Theory“. In: Flick et al.: Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Rowohlt, Reinbek
bei Hamburg: S. 475-485.
Hildenbrand, Bruno (2004) [2000]: „Anselm Strauss“ In: Flick et al.: Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg: S. 32-42.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-9.html
[2] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-50.html
[3] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-122.html
4.3 Qualitätskriterien in der empirischen Sozialforschung
Qualitäts- bzw. Gütekriterien stellen Beurteilungskriterien zur Verfügung, die es erlauben, sowohl das Design, den Prozess, wie auch einzelne Erhebungsinstrumente daraufhin zu beurteilen, ob sie "gut gemacht" sind. Das heißt sie formulieren Regeln und Kriterien, die ein Maß für die Qualität sowohl einzelner Instrumente (Fragebogen, Tests, etc.), als auch ganzer Erhebungen bereitstellen.
Dabei kann zwischen den klassischen quantitativen Qualitätskriterien und verschiedenen Vorschlägen zur Formulierung qualitativer Qualitätskriterien unterschieden werden.
4.3.1 Quantitative Qualitätskriterien
Zu den klassischen quantitativen Qualitätskriterien gehören:
- Objektivität
Diekmann zu Folge kommt die Objektivität eines Messinstruments im Ausmaß zum Ausdruck, in dem die Ergebnisse unabhängig von derjenigen Person sind, die das Messinstrument anwendet. "Vollständige Objektivität liegt vor, wenn zwei Anwender A und B mit dem gleichen Messinstrument jeweils übereinstimmende Resultate erzielen" (Diekmann 1999: 216). Objektivität bezieht sich demnach nicht nur auf die Durchführung einer Messung, sondern auch auf die Auswertung der dabei erhobenen Daten.
- Gültigkeit (Validität)
Gültigkeit (Validität) einer Untersuchung bzw. eines Messinstrumentes bedeutet, dass das gemessen wird was man zu messen beabsichtigt.
Die Frage ist also ob die gewählten Indikatoren, die herangezogen werden, um ein Konzept zu operationalisieren[1] dieses wirklich valide messen.
Die Gültigkeit einer Messung alleine ist allerdings kein Beweis für ihre Zuverlässigkeit.
In der quantitativen Sozialforschung werden unterschiedliche Formen der Validität unterschieden (vgl. etwa Diekmann 1995: 223ff)
- empirische Validität
- Inhaltsvalidität
- Kriteriumsvalidität
- Konstruktvalidität
- Zuverlässigkeit (Reliabilität)
Zuverlässigkeit (Reliabilität) einer Messung bedeutet, dass eine Wiederholungsuntersuchung bei unveränderten Bedingungen zu den gleichen Ergebnissen kommt. D.h. die Reliabilität eines Messinstruments ist ein Maß für die Reproduzierbarkeit von Messergebnissen.
Die Zuverlässigkeit einer Messung ist allerdings kein Beweis für ihre Gültigkeit (dass man das misst, was man messen will) oder Objektivität (dass die Ergebnisse unabhängig von den Personen sind, die sie ablesen).
Im Rahmen sozialer Phänomene ist insbesondere das Kriterium der identischen Bedingungen problematisch und äußerst schwer kontrollierbar, da nicht immer festgestellt werden kann, ob alle relevanten Bedingungen gleich geblieben sind bzw. welche sich verändert haben, ob und welche Lerneffekte bei den Untersuchten eingetreten sind.
- Repräsentativität
Bei der Repräsentativität geht es um die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse, d.h. die Möglichkeit von der untersuchten Stichprobe auf die Grundgesamtheit der Untersuchung zu schließen. Dies setzt voraus, dass die Stichprobe ein nicht systematisch verzerrtes Abbild der Grundgesamtheit ist (siehe Samplingstrategien[2]).
Von repräsentativen Stichproben alleine lässt sich allerdings noch nicht auf die Repräsentativität der Untersuchung schließen. Da man bei den konkreten Erhebungen immer auch Personen nicht antrifft bzw. es zu Verweigerungen kommt, an der Untersuchung teil zu nehmen, müssen auch die wirklich erhobenen Fälle bzw. befragten Personen ein repräsentatives Abbild der Grundgesamtheit sind.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 2.7.1.1
[2] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-8.html
4.3.2 Qualitative Qualitätskriterien
Im Gegensatz zu den quantitativen Qualitätskriterien besteht innerhalb der qualitativen Sozialforschung kein einheitlicher Konsens darüber, welche Qualitätskriterien zentral sind. Aus der Sicht postmoderner Positionen wird die Sinnhaftigkeit von Qualitätskriterien in Frage gestellt und argumentiert, dass die Welt sozial konstruiert sei und dies nicht "mit Standards für die Bewertung von Erkenntnisansprüchen vereinbar" (Steinke 2003: 321) sei. Am anderen Ende des Spektrums wird hingegen versucht, qualitative Qualitätskriterien analog zu den quantitativen Kriterien zu formulieren.
Zwischen diesen beiden Positionen steht die Auffassung, dass die Übertragbarkeit quantitativer Kriterien auf die qualitative Forschung nicht zielführend ist, sich aus dem qualitativen Forschungsprozess aber dennoch eigenständige Qualitätskriterien ergeben. Im Folgenden sollen nur einige, oft thematisierte Kriterien genannt werden. Dazu gehören:
- Transparenz und Nachvollziehbarkeit
Dies meint den Forschungsprozess explizit zu machen, die einzelnen Schritte und zentralen Entscheidungen zu verdeutlichen.
- Prozesshaftigkeit und Offenheit
Ein zentrales Kriterium qualitativer Forschungsprozesse ist der nicht im Vorfeld festgelegte Forschungsablauf, sondern die offene Prozesshaftigkeit der Forschung in Auseinandersetzung mit dem untersuchten Feld. Offenheit bezieht sich allerdings nicht nur auf den Forschungsprozess, sondern auch auf die Ergebnisoffenheit Theorie und Hypothesen entwickelnder Forschung.
- Flexibilität
Aus diesen beiden Kriterien ergibt sich die Notwendigkeit der Flexibilität im Rahmen qualitativer Sozialforschung im Sinne einer permanenten Anpassung an neue bzw. veränderte Bedingungen und Erkenntnisse.
- Kommunikation als Basis
Im Rahmen qualitativer, insbesondere ethnographischer Forschung werden das Ausmaß und die Intensität der kommunikativen Beziehung zum untersuchten Feld zu einem zentralen Qualitätskriterium. Diese kommunikative Beziehung kann im Sinne einer kommunikativen Validierung auch zu einer Überprüfung der Ergebnisse durch die Untersuchten vor Ort führen.
- Authentizität
wurde mit den Äußerungen der Untersuchten und deren Wertstrukturen sorgfältig umgegangen, wurden die multiplen Konstruktionen der Untersuchten angemessen erhoben, und diese kommunikativ validiert.
- Triangulation
Der Einsatz verschiedener Methoden, Theorien und Daten wurde lange Zeit als ein Kriterium zur Erhöhung der Gültigkeit (Validität) betrachtet. Dabei ging man davon aus, dass Daten die mittels verschiedner Methoden (z.B. quantitativer Fragebogen, teilnehmende Beobachtung) erhoben wurden und auf die gleichen Phänomene und Besonderheiten verweisen, besonders gültig seien. Eine andere Auffassung, die insbesondere auch für die ethnographische Feldforschung relevant ist, geht im Gegensatz dazu davon aus, dass Triangulation zu einer breiteren Dokumentation und zu einem umfassenderen Verständnis des Untersuchungsgegenstandes führt.
- Plausibilität
Plausibilität wird in der qualitativen Sozialforschung im Sinne einer intersubjektiven Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses und der daraus folgenden Bewertung der Ergebnisse verstanden. Dies steht im Gegensatz zu einer Überprüfbarkeit und Replizierbarkeit quantitativer Untersuchungen und trägt dem Umstand Rechnung, dass eine identische Wiederholung einer Untersuchung wegen der begrenzten Standardisierbarkeit qualitativer Forschungsvorhaben nicht möglich ist.
- Gegenstandsangemessenheit
Das Kriterium der Gegenstandsangemessenheit bezieht sich nicht nur auf die Datenerhebung und die Methodenauswahl, sondern auf den gesamten Forschungsprozess und besagt, dass Forschungsprozesse insbesondere dann qualitätsvoll sind, wenn sie sich auf eine angemessene und verständnisorientierte Art und Weise dem Feld annähern.
- Limitation
Unter Limitation versteht man die Notwendigkeit die Grenzen der Aussagen anzugeben, die in Forschungsberichte Eingang finden. Es geht also darum, den Geltungsbereich und das Ausmaß der Verallgemeinerbarkeit von Aussagen, Hypothesen und Theorien explizit zu machen.
4.4 Literatur
Böhm, Andreas (2004 [2000]): „Theoretisches Codieren: Textanalyse in der Grounded Theory“. In: Flick et al.: Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg: 475-485.
Diekmann, Andreas (1995): Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg.
Hildenbrand, Bruno (2004 [2000]): „Anselm Strauss“ In: Flick et al.: Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg: 32-42.
Steinke, Ines (2004 [2000]): Gütekriterien qualitativer Forschung. In: Flick et al.: Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg: 319-331.
Strauss, Anselm; Corbin, Juliet (1996): Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Beltz Psychologie Verlags Union, Weinheim
- (1996): Theoretisches Sampling. In: dies. Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Beltz, Psychologie Verlags Union, Weinheim: S.148-165.
Witt, Harald (2001): Forschungsstrategien bei quantitativer und qualitativer Sozialforschung. Forum Qualitative Sozialforschung[1] (Online-Journal), 2(1).
Wulff, Helena (2002): ’Yo-yo- fieldwork: mobility and time in a multi- local study of dance in Ireland’, Anthropological Journal on European Culture 11: 117-136.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/969
5 Ausgewählte Weiterentwicklungen der ethnographischen Feldforschung
Die methodischen Anweisungen und Grundlagen der Feldforschung, wie sie Malinowski[1] formuliert hat, haben Standards innerhalb der Disziplin gesetzt. Insbesondere die teilnehmende Beobachtung wurde zu einem identitätsbildenden Kern der Disziplin. Dennoch kam es im Laufe des 20. Jahrhunderts zu zentralen Weiterentwicklungen der ethnographischen Verfahren. Diese sind durch unterschiedliche, miteinander in Beziehung stehende Entwicklungen bedingt.
Dazu gehört
- die Veränderung der kultur- und sozialanthropologischen Forschungsfelder,
- die Veränderung des Verständnisses ethnographischer Daten: von der objektiven Abbildung zu Daten zweiter Ordnung
- die Entwicklung neuer theoretischer Perspektiven,
- die Entwicklung neuer technischer Möglichkeiten der Dokumentation und Analyse, z.B. durch audio-visuelle Aufnahmegeräte und den Einsatz von Computern,
- und damit zusammenhängend neue Formen der Darstellung ethnographischer Ergebnisse, die über die klassische Monographie hinausgehen.
Im Folgenden sollen einige dieser Entwicklungen skizziert werden.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 1.4
5.1 Ordnung vs. Konflikt: Die Extended-Case Method
Innerhalb der britischen Sozialanthropologie kam es ab den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem bis dahin vorherrschenden (struktur)funktionalistischen Paradigma, welches durch B. Malinowski und A. R. Radcliffe-Brown geprägt wurde. Dieses stellte auf vermeintlich stabile soziale Strukturen ab und, wie bereits anhand des klassischen Modells der Feldforschung von Malinowski[1] gezeigt wurde, dienten direkte Beobachtungsdaten und indigene Klassifikationen primär dazu, diese allgemeinen Ordnungsmodelle zu illustrieren und möglichst anschaulich zu vermitteln. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde zunehmend deutlich, dass diese Modelle eine eigene Selektivität der Darstellung produzierten und aktuelle Phänomene, wie antikoloniale Bewegungen, Industrialisierung und Urbanisierung neue Herausforderungen an das methodische Vorgehen stellten.
Eine methodische Antwort auf diese Herausforderung war die Entwicklung der extended-case method (ECM), die insbesondere von Max Gluckman[2] vorgenommen wurde und mit der so genannten Manchester Schule der britischen Anthropologie in Zusammenhang steht. Die zentrale Umorientierung besteht darin, nicht vermeintlich stabile Ordnungsstrukturen ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu stellen, sondern "den Wettbewerb individueller Akteure um Ressourcen und Status im Rahmen widersprüchlicher, inkonsistenter Normen und Regeln" (Rössler 2003: 144). Im Zentrum der ethnographischen Darstellung stand "das alltägliche Handeln konkreter Personen in der sozialen Praxis" (ebd.) und nicht eine abstrahierte Struktur. Dieses Verfahren stellt darauf ab, die Entwicklung sozialer Konflikte, das Aushandeln individueller Interessen, die unterschiedliche Interpretation sozialer Regeln und Normen darzustellen. Dadurch gewinnt die zeitliche Dimension in der ethnographischen Darstellung im Gegensatz zur rein synchronen Betrachtung eine zentrale Bedeutung. Dies führt zur Durchführung von Langzeit- und Wiederholungsstudien, welche es erlauben, den Wandel in den sozialen Beziehungen zu dokumentieren. Wandel, Abweichung und divergierende Interessen werden nun nicht mehr als dysfunktionale Abweichung von im Prinzip harmonischen Strukturen betrachtet, sondern als zentraler Bestandteil des sozialen Lebens. Es steht also nicht mehr die Suche nach Ordnung und allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, wie noch bei Malinowski, im Zentrum. Vielmehr wird die vermeintliche, funktionalistische Kohärenz des Ganzen durch eine Konfliktorientierung der ethnographischen Vorgangsweise abgelöst.
Die extended-case method wurde primär aus der Analyse von Rechtsfällen (cases) entwickelt und ist akteurs-, handlungs- und prozessorientiert. Mitchell (1983: 193f) schlägt folgende ethnographische Verfahren vor:
1) Die angemessene Illustration (abt illustration) eines einzelnen Ereignisses, welches ein generelles Prinzip illustriert.
2) Die Situationsanalyse, welche mehrere miteinander verbundene Situationen innerhalb eines begrenzten Zeitraumes miteinander verbindet.
3) Die extended-case method, welche solche Situationen mit denselben Akteuren über einen längeren Zeitraum hinweg miteinander verbindet.
4) Die Analyse sozialer Dramen, welche Mitchell als inhaltlich und zeitlich beschränkte extended-case method bezeichnet.
Rössler (2003: 146) stellt zu diesen Verfahren fest, dass es sich bei den letzen drei Punkten um das selbe methodische Prinzip mit unterschiedlichen "Nuancen hinsichtlich zeitlicher Tiefe und der Komplexität der dargestellten sozialen Beziehungen (handelt). Es ist von daher durchaus legitim, alle genannten Verfahren 2-4 als ECM zu bezeichnen."
Innerhalb der ECM ist eine detaillierte Kenntnis des Feldes und der einzelnen Fälle notwendig, denn "bevor die Manipulation von Regeln und Institutionen (...) methodisch in den Mittelpunkt gerückt werden können, muss ein umfassendes Wissen über die besagten Regeln und Institutionen erworben sein" (Rössler 2003: 148). Dazu gehört eine lange Feldforschungsdauer, eine intime Kenntnis der untersuchten Gemeinschaft, ein gutes Vertrauensverhältnis zu den untersuchten Personen, eine gute Kenntnis der lokalen Sprache, ebenso ist es notwendig die Vorgeschichte der Ereignisse zu dokumentieren.
Zu den methodischen Problemen der ECM gehören der besonders hohe Zeit- und Arbeitsaufwand aber auch die Notwendigkeit Informationen zur Vorgeschichte der einzelnen Fälle zu erheben, wobei man auf die selektiven Aussagen der Informanten angewiesen ist. Auch die Frage der Repräsentativität der Fälle und deren Auswahl stellt sich als schwierig dar. Einerseits erfordert die detaillierte Dokumentation ausgewählter Fälle eine Auswahl, andererseits will laut Rössler (2003: 149) die ECM nicht die gesamte Gesellschaft erfassen sondern auf der Mikroebene exemplarische Akteure und ihre Handlungen dokumentieren. Es geht um "bewusst nach räumlichen und zeitlichen Kriterien definierten Ausschnitten der alltäglichen Praxis" (ebd.). Als weiterer methodisch problematischer Punkt wird die unvermeidbare Einbindung des Ethnographen als Mitwisser in Krisen- und Konfliktsituationen genannt, welche besondere ethische Probleme[3] mit sich bringt.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 1.4
[2] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/organthro/organthro-38.html
[3] Siehe Kapitel
5.2 Methodische Entwicklungen durch die Culture und Personality School
Die zweite Generation von Boas SchülerInnen', zu denen u.a. Margaret Mead, Ruth Benedict, Clyde Kluckholm und Ralph Linton gehörten, wendeten sich von der historischen Agenda Boas ab und einer synchronen Analyse zu. Dabei waren sie sowohl von der Psychoanalyse, wie der Gestaltpsychologie aber auch vom britischen Funktionalismus und den 'malinowskischen Feldforschungsmethoden[1] beeinflusst. Erstmals wurden auch Feldforschungen außerhalb der USA, insbesondere im Pazifik, durchgeführt und neue Themen, wie Jugend und Gender erforscht.
Insbesondere Margaret Mead betonte die Notwendigkeit umfassender Feldforschungstechniken und den Bedarf an teilnehmender Beobachtung zur Aufnahme des Alltagslebens. Sie misst der Sprachkompetenz im Vergleich zu Boas geringere Bedeutung bei und argumentiert, dass es ausreichend ist, wenn AnthropologInnen die Sprache so weit beherrschen, dass sie alltägliche Gespräche verstehen, Vertrauen aufbauen und grundlegende Fragen stellen können. Es geht also weniger darum komplexe Textsammlungen und Übersetzungen anzufertigen, als um alltagssprachliche Kompetenz, die zur Beobachtung des Alltagslebens notwendig ist.
Margaret Mead entwickelte gemeinsam mit Gregory Bateson' in Bali und Papua Neuguinea neue minutiöse Methoden der Datenerhebung[2]', die insbesondere auf der visuellen Dokumentation von Verhalten mittels systematischer Foto- und Filmdokumentation beruhten.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-57.html
[2] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-20.html
5.3 Dichte Beschreibung und interpretative Ethnographie
Clifford Geertz[1] leitete innerhalb der Ethnographie die so genannte interpretative Wende ein, aus der auch eine Veränderung des Objektverständnisses und eine Neubestimmung des ethnographischen Tuns resultiert. Er vollzieht damit eine Wende zur Hermeneutik[2]. Seine Grundannahme ist, dass der Mensch der Welt immer einen Sinn verleiht, die Welt also immer schon interpretiert ist. Bei den Interpretationen der lokalen InformantInnen und jenen der Kultur- und SozialanthropologInnen handelt es sich also nur um Interpretationen auf unterschiedlichen Ordnungsebenen[3]. Die Erschließung dieses Sinns bzw. der Bedeutung wird zum zentralen Moment der interpretativen Ethnographie, aber auch der Auffassung von Kultur, die Geertz seinen Überlegungen zu Grunde legt. Er schreibt: "Ich meine mit Max Weber, dass der Mensch ein Wesen ist, das in selbst gesponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe" (Geertz 1983: 9). Diese Bedeutungen sind den Angehörigen einer Gesellschaft sozial verfügbar und dem/der FeldforscherIn, der/die sich diese aneignen will, zugänglich. Geertz legt seinen Untersuchungen also einen nicht-subjektivistischen Bedeutungsbegriff zu Grunde. "Bedeutung ist etwas Öffentliches." (Geertz 1983: 18)
Aus dieser Orientierung rücken die kulturellen Artikulationsweisen und Objektivierungen sowie die symbolischen Dimensionen des sozialen Handelns ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Es geht also nicht um reine Verhaltensbeobachtung, sondern um eine bedeutungstheoretische Fundierung sozialer Handlungen und Prozesse.
An dieser Unterscheidung schließt auch die Differenz von dünner und dichter Beschreibung an, welche Geertz in Anlehnung an Ryle (1971) an Hand eines zwinkernden Jungens veranschaulicht. Eine dünne Beschreibung beschreibt bloß, was der Junge tut (schnell das rechte Augenlid bewegen), während eine dichte Beschreibung diese Tätigkeit im kulturellen Kontext interpretiert und versucht die kulturellen Kategorien des Verständnisses dieser Tätigkeit zu identifizieren. So kann es sich bei dem Zwinkern bloß um ein Nervenleiden handeln, aber auch um ein "bißchen Verhalten, ein wenig Kultur und - voilá - eine Gebärde" (ebd.: 11). Es kann also ein Kode zwischen Freunden sein, mittels dem eine bestimmte Nachricht absichtlich an eine ausgewählte Person, nach gesellschaftlich festgelegten Regeln, übermittelt wird, ohne dass die anderen Anwesenden davon wissen. Es kann sich aber auch um eine Parodie handeln, die das Zwinkern eines Anderen lächerlich macht, oder aber um eine Probe, wenn der Junge vor einem Spiegel steht und das Zwinkern übt. In all den Fällen geht es um bestimmte kulturelle Bedeutungen des Zwinkerns und bestimmte Interpretations- bzw. Auslegungsmöglichkeiten dieses Verhaltens. Dichte Beschreibungen beinhalten die Bedeutungsebenen des Verhaltens.
Forschungstechnisch geht es Geertz also um die Deutung von Symbolsystemen und nicht primär um Empathie mit den Beforschten. Es geht ihm nicht darum, den Standpunkt der Anderen einzunehmen, vielmehr will er die kulturell verfügbaren Handlungsorientierungen aufdecken. Seine Analyse des sozialen Handelns fokussiert auf die Handlungsorientierung und die damit verbundenen Bedeutungen, nicht aber - etwa im Gegensatz zu Pierre Bourdieu - auf die Handlungspraxis. Ganz im Sinne einer nicht- positivistischen und hermeneutischen Tradition fordert Geertz eine Wissenschaft, die nicht nach Gesetzen sucht, sondern interpretiert und Bedeutungen finden will.
Daraus folgt auch, dass die ethnologische Forschung nach Geertz nicht primär eine Sache der Beobachtung ist, sondern vielmehr eine der Interpretation und Analyse des Beobachteten. Hauptteil der ethnographischen Beschreibungen sind nicht konkrete Verhaltensweisen, sondern die darin enthaltenen Bedeutungsstrukturen. Die ethnographische Analyse besteht im Herausarbeiten dieser Bedeutungsstrukturen und dem Bestimmen ihrer gesellschaftlichen Tragweite. Was tut also der Ethnograph? Er "’schreibt’ den sozialen Diskurs ’nieder’, er hält ihn fest" und es ist seine Aufgabe "dem Ganzen" (Geertz 1987: 28) eine vermutete Bedeutung zu verleihen und diese zu bewerten. Kurz: Geertz zu Folge besteht die Untersuchung von Kultur darin, Vermutungen über Bedeutungen anzustellen, diese Vermutungen zu bewerten und aus den besten Vermutungen erklärende Schlüsse zu ziehen. Es handelt sich also um eine kontextgebundene, mikroskopische und kulturrelativistische Herangehensweise.
Aus dem mikroskopischen Modell der Geertz’schen Ethnographie folgt, dass die untersuchte Mikroebene immer im Licht der allgemeinen Kultur und kulturellen Bedeutungen interpretiert wird (Jonesville-ist-die-USA bzw. der Hahnenkampf[4] ist ein Ausdruck der balinesischen Kultur).
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-65.html
[2] Siehe Kapitel 2.3.1
[3] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-66.html
[4] Siehe Kapitel
5.4 Postmoderne Kritik, literal turn und die Krise der Repräsentation
Interpretationen als Vermutungen über Bedeutungen sind also etwas Gemachtes oder Hergestelltes. Geertz zu Folge sind sie also keine Fakten, sondern Fiktionen.
Geertz wird damit zum Wegbereiter der postmodernen Kritik und der writing culture-Debatte (Marcus und Fischer 1986; Clifford und Marcus 1986). Diese gehen davon aus, dass Anthropologie ihren Gegenstand nicht repräsentiert, sondern erfindet. Geertz beharrt allerdings auf der Vorstellung, dass Kultur eine gegebene und abgrenzbare Einheit sei, deren Bedeutung verstanden und erschlossen werden kann. Im Gegensatz dazu stellen postmoderne AutorInnen eine kulturelle Gesamtbedeutung in Frage und fokussieren vielmehr auf die Vielstimmigkeit und Polyphonie der Diskurse. D.h. sie gehen von widersprüchlichen Vorgängen kultureller Bedeutungsproduktion aus und wenden sich gegen "große Erzählungen", die eine Gesamtbedeutung unterstellen.
In weiterer Folge wurden die ethnographischen Beschreibungen selbst als solche Erzählungen gelesen und hinterfragt. Daraus resultierte z.B. die literaturwissenschaftlich inspirierte Frage, welche Strategien AutorInnen anwenden, um ihren Ethnographien Autorität zu verleihen. In den "künstlichen Wilden" (1990) untersucht Geertz diese Strategien in klassischen Ethnographien von Claude Lévi-Strauss, Bronislaw Malinowski, Evans-Pritchard und Ruth Benedict. Ethnographie wird aus dieser Leseweise zu einem Spiel mit unterschiedlichen Textverfahren und literarischen Strategien, welches in letzter Konsequenz mehr über den/die AutorIn, als über die Untersuchten aussagt. Geertz zu Folge gibt es bei der Ethnographie - ähnlich wie in der Kunst - keine Grenze zwischen Darstellungsweise und zugrunde liegendem Inhalt, was in weiterer Folge zu einer Kritik der klassischen Darstellungsweise anthropologischer Erkenntnisse in Form von Ethnographien führt. Insgesamt führte diese Entwicklung insbesondere innerhalb der US- amerikanischen Anthropologie zu einem Fokus auf die Politik des Schreibens, die Frage der Darstellung und der Repräsentation, während die Methodendiskussion in den Hintergrund rückte. Dies führte zur Forderung nach experimentellen Schreibstrategien und neuen Darstellungsformen jenseits der klassischen "großen Erzählungen".
In dieser Auffassung wird Ethnographie mit dem Schreiben gleich gesetzt und die Unterscheidung zwischen Feldforschung (der Teilnahme, dem Beobachten, der dabei generierten Erfahrung) und dem Aufschreiben bzw. zwischen ethnographischen Daten und der Theorie annulliert. Schreiben ist Theorie und die ethnographische Erfahrung und ihre Repräsentation im Schreiben sind aus einem Guss. (vgl. Silverman 2005: 324)
In diesem Sinne ist auch Stephen Taylors Definition der postmodernen Ethnographie zu verstehen: "a cooperatively evolved text consisting of fragments of discourse intended to evoke ... a emergent fantasy of a possible World of commonsense reality .... It is, in a word, poetry." (in Clifford und Marcus 1986: 125)
So wurden dialogisch-plurivoke Textstrategien sowie Strategien multipler Autorenschaft vorgeschlagen, welche die Polyphonie der Stimmen besser repräsentieren sollten. Kulturelle Phänomene und Prozesse sollten evoziert statt repräsentiert werden. Dabei wurde übersehen, dass die Anordnung dialogisch-plurivokaler Texte selbst wieder eine Schreib- und Darstellungsform ist, die in letzter Konsequenz wieder eine/n AutorIn und seine/ihre Selektionen erfordert. Noch wichtiger ist, dass die Versuche nicht autoritative plurivokale Texte zu produzieren nicht zur Aufhebung von Autoritäts-, Macht- und Ausbeutungsverhältnissen in der realen Welt führt. Die postmoderne Wende und literarische Kritik hat vielmehr dazugeführt, dass das Interesse weg von sozialen Institutionen, Machtverteilungen und materiellen Bedingungen einseitig auf die Ebene der Texte und Symbolik verschoben wurde. Dies führte zu einer mangelnden Beachtung des politisch- gesellschaftlichen Kontextes und zu einer radikalen Verabschiedung des Repräsentationsmodells, was in letzter Konsequenz zu einer Verunmöglichung der Erkenntnis von politischen Machtstrukturen führt. Nicht zu letzt deshalb wurden die Werke von Clifford, Marcus und Fischer radikal kritisiert, insbesondere auch von positivistischen WissenschaftlerInnen, wie etwa Marvin Harris[1], deren Ziel es ist, verifizierbare Wahrheiten zu erforschen. So bezeichnet Harris diese Gruppe von Autoren als "untrained would-be novelists and ego-tripping narcissists afflicted with congenial logo-diarrhea." (Silverman 2005: 325)
Gleichzeitig arbeitet eine Wissenschaft, die vorgibt nur Fiktionen zu produzieren, systematisch an ihrer eigenen Bedeutungslosigkeit. Das methodisch Zentrale an diesen Diskussionen ist aber die reflexive Einsicht, dass es sich bei ethnographischen Daten nicht um eins zu eins Abbildungen einer objektiven Realität handelt. Im Gegensatz zu solchen direkten Abbildungen erster Ordnung, sind ethnographische Daten solche zweiter oder höherer Ordnung. Es handelt sich also um Interpretationen von Interpretationen bzw. um Beobachtungen von Beobachtungen. Insofern beinhalten sie immer auch die Perspektive des/der EthnographIn. D.h. sie können sowohl darauf hin gelesen werden, was sie uns über einen bestimmten Ausschnitt der Welt sagen, wie was sie uns über den/die EthnographIn, seine/ihre Herkunft, seine/ihre theoretischen Annahmen und seine/ihre methodische Vorgangsweise vermitteln.
Erst aus diesem doppelten Charakter der Daten erschließt sich ihre Aussagekraft und Bedeutung. Die gilt für alle im Zuge sozialwissenschaftlicher Forschungen erhobenen/produzierten Daten, nicht nur für ethnographische Beschreibungen. Auch scheinbar harte statistische Daten können darauf hin befragt werden, was sie uns über einen bestimmten Ausschnitt der Welt berichten oder darauf hin, durch welche Form der Operationalisierung[2] und Fragebogenkonstruktion diese Daten zu Stande gekommen sind.
Das besondere Qualitätsmerkmal ethnographischer Daten besteht, im Gegensatz zu anderen sozialwissenschaftlichen Daten, darin, dass sie auf einer ethnographischen Erfahrung beruhen, die durch lang andauernde und intensive Beziehungen zum Feld generiert werden. Ihre Qualität liegt also in einer intimen persönlichen Kenntnis der Praxis und nicht nur in einem Sammeln verbaler Aussagen über diese. Die zentralen methodischen Probleme sind somit die Transformation der ethnographischen Erfahrung[3] in ethnographische Daten und Beschreibungen sowie deren Analyse[4].
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Marvin_Harris
[2] Siehe Kapitel
[3] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-93.html
[4] Siehe Kapitel
5.5 Globale Welt und multi-sited Ethnography
Eine weitere Herausforderung für eine aktuelle Ethnographie ergibt sich aus den Prozessen der Globalisierung und den daraus folgenden Konsequenzen für das Verständnis von Kultur. In den 90er Jahren wurde die räumliche Verortung von Kultur kritisiert, hinterfragt und neu konzeptioniert (z.B. Gupta und Ferguson 1997). Die Vorstellung von Kulturen als abgrenzbare, homogene Ganzheiten, die mit bestimmten Orten oder Regionen in einem ursächlichen Zusammenhang stehen, wurde verworfen und machte einem dynamischen nicht- essentialistischen Kulturverständnis Platz, welches versucht lokale Subjekte und Gesellschaften in ihren vielfältigen Beziehungen mit dem Weltsystem in Verbindung zu bringen und in seine Strukturen einzubetten. Dies führte auch zu einer Neudefinition des ethnographischen Feldes und der Feldforschung jenseits einer lokal verankerten Örtlichkeit. Das Feld ist somit nichts mehr Gegebenes, Einheitliches und an einem Ort Lokalisierbares, sondern muss im Zuge der Feldforschung erst konstruiert und konstituiert werden (Amit 2000).
Ein Vorschlag der Konstitution eines solchen multiplen Feldes stammt von George Marcus und wurde unter dem Begriff der multi-sited ethnography bekannt. Ziel der multi-sited ethnography ist es, transnational und global agierende Lebenswelten ethnographisch erforschen zu können und sie geht von der Annahme aus, dass „any ethnography of a cultural formation in the world system is also an ethnography of the system, and therefore cannot be understood only in terms of the conventional single site mise-en-scène of ethnographic research ..." (Marcus 1995:83). Das Objekt der Untersuchung ist unter diesen Bedingungen mobil und mehrfach verortet. Ziel des Verfahrens ist es, diese vielfachen Verortungen, die oft als getrennte Welten wahrgenommen werden, miteinander in Beziehung zu setzten. Das Objekt der Untersuchung wird also an unterschiedlichen Örtlichkeiten erforscht, was dazu führt, dass diesem Verfahren eine vergleichende Dimension inhärent ist, ohne jedoch im Vorfeld von abgeschlossenen oder homogenen Einheiten auszugehen.
George Marcus schlägt sechs Strategien vor, die zu einer Verknüpfung von Feldern im Sinne einer multi-sited ethnography führen. Dazu gehören die Aufforderungen
- Follow the people: Damit ist die Ausrichtung der ethnographischen Recherche entlang der Entwicklungen und Bewegungen von bestimmten Personen und Gruppe gemeint, z. B. im Zuge von Migrationsprozessen.
- Follow the Thing: Hier ist das Nachspüren von Zirkulationsprozessen von Dingen wie beispielsweise Waren, Geschenken, Geldflüssen oder Kunst gemeint, welche ein multipel verortetes Feld konstituieren. Als klassisches Beispiel kann hier etwa Sidney Mintz kulturhistorische Analyse des Zuckers (1985) genannt werden.
- Follow the Metapher: Wenn sich das Objekt der Untersuchung innerhalb von Diskursen und Arten und Weisen zu denken manifestiert, dann spielt die Zirkulation von Zeichen, Symbolen und Metaphern eine zentrale Rolle und kann die Konstitution eines multiplen Feldes anleiten. Marcus nennt in diesem Zusammenhang etwa Martins Untersuchung "Flexible Bodies" (1994), welche darauf abstellt, die Arten und Weisen, wie über das menschliche Immunsystem an verschiedenen Orten innerhalb der amerikanischen Gesellschaft gedacht wird ethnographisch abzubilden. Dabei verknüpft sie Darstellungen in den Massenmedien, auf der Straße im Zusammenhang mit der Behandlung von Aids im Bereich alternativer Therapietechniken und unter WissenschaftlerInnen.
- Follow the Plot, Story, or Allegory: Hier werden Geschichten oder Erzählung, die an einem Feldforschungsort in Erfahrung gebracht werden, als Ausgangspunkt genommen, um ein multipel situiertes, ethnographisches Forschungsprojekt zu entwickeln. Marcus schreibt: "Reading for the plot and then testing this against the reality of ethnographic investigation that constructs its sites according to a compelling narrative is an interesting, virtually untried mode of constructing multi-sited research." (1998 [1995]: 93)
- Follow the Life or Biography: Hier wird die Lebensgeschichte einer Person dazu verwendet, unterschiedliche Örtlichkeiten und ethnographische Felder miteinander in Beziehung zu setzten und die Lebensgeschichte entlang und durch diese verschiedenen Felder verfolgt.
- Follow the Conflict: Eine weitere Form, Felder miteinander zu verknüpfen, besteht darin, den unterschiedlichen Parteien in Konflikten zu folgen, wie es auch innerhalb der Extended-Case Method[1] bereits gemacht wurde. (vgl.: Marcus 1995: 90ff)
Der Vorteil der multi-sited ethnography besteht also in der systematischen Verknüpfung unterschiedlicher und geographisch und sozial oft sehr weit entfernter Felder. Die Schwierigkeit dieser Strategie ergibt sich daraus, dass die einzelnen Felder bei einer insgesamt gleich bleibenden Feldforschungsdauer nur vergleichsweise kurz und oberflächlich untersucht werden können. Dadurch besteht die Gefahr, dass eine zentrale Stärke der ethnographischen Feldforschung verloren geht und dies führte auch zur Kritik an den resultierenden "traveling anthropologists".
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel
5.6 Transnationale Forschungen
Während die interpretative Anthropologie Clifford Geertz, die postmoderne Kritik der Writing Culture und die daraus resultierenden Überlegungen zur multi-sited Ethnography selbstreflektive Mikroanalysen ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit stellen, steht die transnationale Anthropologie in einem stärkeren Naheverhältnis zu einem Projekt der Makroanthropologie, welches auch die übergeordneten Strukturen der globalen Transformation der Welt in den Blick nimmt. Als Vorläufer sind hier insbesondere die Weltsystemtheorie Immanuel Wallersteins und die aus einer anthropologischen Perspektive darauf reagierende klassische Untersuchung Eric Wolfs "Die Völker ohne Geschichte" zu nennen, sowie in späterer Folge die Arbeiten von Arjun Appadurai (1996) und Ulf Hannerz (1992, 1996).
Transnationale Forschung (vgl. Hannerz 1998) überschreitet die Grenzen politisch definierter Einheiten und setzt räumlich gesehen weit entfernte Örtlichkeiten miteinander in Beziehung. Solche Forschungsfelder umfassen eine Bandbreite unterschiedlicher Bedeutungen und kultureller Formen. Sie fokussiert insbesondere auf die Verbundenheit, den Austausch, die Mobilität und die Interaktion zwischen unterschiedlichen Örtlichkeiten, sowie die Besonderheiten nationaler bzw. lokaler Aneignungen und Kontextualisierungen von Phänomenen. Sie hat somit auch eine vergleichende Dimension, ohne aber - wie die traditionelle vergleichende Anthropologie - von unabhängigen oder abgeschlossenen Untersuchungseinheiten auszugehen.
Zentrale Foschungsthemen und -bereiche, die aus dieser Perspektive Wichtigkeit erlangen sind Formen des Widerstandes gegenüber translokalen Einflüssen, aber auch die dadurch entstehende kulturelle Kreativität und neue Formen kultureller Diversität, der Hybridität und Kreolisierung.
Zu den untersuchten Translokalitäten (Appadurai 1995: 216) gehören Knotenpunkte innerhalb der transnationalen kulturellen Prozesse. Solche sind etwa Hotels, Flughäfen, Weltstädte oder Weltausstellungen, also Örtlichkeiten, die durch Mobilität und dem Zusammentreffen von Menschen unterschiedlicher Herkunft geprägt sind, die Marc Augé (1994) auch als Nicht-Orte bezeichnet.
Solche Translokalitäten werden auch entlang politischer Grenzen untersucht (border studies), wobei insbesondere die grenzüberschreitenden Beziehungen in den Fokus genommen werden. Es wird also das Verbindende und nicht das Trennende an den Grenzen thematisiert. Hier reihen sich auch die mittlerweile klassischen Themen der Migration und der Diaspora ein.
Andere zentrale Forschungsbereiche sind transnationale Organisationen und Unternehmen, Medien, Cyberspace aber auch Waren und das "soziale Leben von Objekten" (Appadurai 1988) in einer globalisierten Welt.
Methodisch basieren diese transnationalen Forschungen auf klassischen Verfahren, wie der teilnehmenden Beobachtung, dem Arbeiten mit Informanten, der Aufnahme von Lebensgeschichten, unterschiedlichen Interviewtechniken und textanalytischen Verfahren. Insgesamt kommt dem reinen face-to-face-Kontakt mit den Beforschten jedoch eine nicht mehr ganz so zentrale Rolle zu, da insbesondere die Untersuchung von Medien und medialen Produkten einen wichtigen Bestandteil dieser Untersuchungen darstellt.
Auch hier entscheidet das Thema bzw. das zu untersuchende Problem wer, wo und was untersucht wird. Die Untersuchungseinheiten sind aber nicht nur mulitlokal bzw. multi-sited, sondern translokal. Es handelt sich um ein Netzwerk von Örtlichkeiten und die deterritorialisierten Beziehungen zwischen diesen, wobei eine adäquate Konzeptualisierung und Beschreibung der translokalen Beziehungen und Verbindungen eine zentrale Rolle spielen (siehe Hannerz 1998).
5.7 Literatur
Amit; Vered (2000): Constructing the Field. Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World. Routledge: London, New York.
Appadruai, Arjun (1988): The social Live of Things. Cambridge University Press, Cambridge.
- (1996): Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. University of Minnesota Press: Minneapolis.
Augé, Marc (1994): Orte und Nicht-Orte. Vorlegungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit. Fischer, Frankfurt am Main.
Clifford, James; George, Marcus (Hrsg.) (1986): Writing Culture: The Poetics und Politics of Ethnography. University of California Press: Berkeley.
Fischer, Hans (2003): Dokumentation. In: Beer, Bettina (Hg.) Methoden und Techniken der Feldforschung. Reimer Verlag, Berlin: S. 264-294
Geertz, Clifford (1987): Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- (1990): Die künstlichen Wilden. Anthropologen als Schriftsteller. Hanser, München, Wien.
- (1997): Spurenlesen. Der Ethnologe und das Entgleiten der Fakten. Beck, München.
Gottowik, Volker (1997): Konstruktionen des Anderen. Clifford Geertz und die Krise der ethnographischen Repräsentation. Reimer Verlag, Berlin.
Gupta, Akhil; Ferguson, James (1997): Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology. Duke University Press, Durham.
Hannerz, Ulf (1992): Cultural Complexity. Columbia University Press, New York.
- (1996): Transnational Connections. Routledge, London.
- (1998): Transnational Research. In: Bernard, Russell (Hg.): Handbook of Methods in cultural Anthropology. Altamira Press, Walnut Creek: S 235-258.
Marcus, Geroge (1998): Ethnography through thick and thin. Princeton University Press, Princeton.
Marcus, Geroge; Fischer, Michael (1986): Anthropology as cultural critique. Chicago Press, Chicago.
Malinowski, Bronislaw (1985): Ein Tagebuch im strikten Sinn des Wortes. Neuguinea 1914 - 1918. Syndikat Verlag, Frankfurt am Main.
Martin, Emily (1994): Flexible Bodies: Tracing Immunity in American Culture from the Days of Polio to the Age of Aids. Beacon, Boston.
Mintz, Sidney (1985): Sweetness and Power. The Place of Sugar in modern History. Viking, New York.
Rössler, Martin (2003): Die Extended-Case Methode. In: Beer, Bettina (Hg.): Methoden und Techniken der Feldforschung. Reimer Verlag, Berlin: S. 143-160.
Ryle, Gilbert (1971): Collected Papers. Hutchinson, London. (2 Bände)
Silverman, Sydel (2005): The United States. In: Barth, Frederik; Gingrich, Andre; Parkin, Robert; Silverman, Sydel (2005): One Discipline Four Ways: British, German, French, and American Anthropology. University Of Chicago Press, Chicago.
Wallerstein, Immanuel (1986): Das moderne Weltsystem. Promedia, Wien.
Wolf, Eric (1986): Die Völker ohne Geschichte. Europa und die andere Welt seit 1400. Campus-Verlag, Frankfurt am Main.
6 Strategien der Datenanalyse
Grundsätzlich sind die Entscheidungen, die in Bezug auf die Datenanalyse zu treffen sind, von mehreren Faktoren abhängig. Dazu gehören
- die theoretische Ausrichtung des Projekts und die verfolgten Forschungsfragen,
- die Art der im Projekt erhobenen bzw. zu analysierenden Daten,
- daraus resultierende mögliche Analyseebenen,
die mit spezifischen methodischen Verfahren weiter verfolgt werden können.
Bei der Auswahl geeigneter Datenanalysemethoden ist also darauf zu achten, dass diese der theoretischen Ausrichtung des Projekts und den vorhandenen Daten entsprechen und dazu beitragen, die verfolgten Fragestellungen auf ausgewählten Analyseebenen systematisch und gewinnbringend bearbeiten zu können.
Es sollte beachtet werden, dass spezifische Datenanalyseverfahren nicht nur mit Datenerhebungsstrategien in Zusammenhang stehen, sondern auch mit (erkenntnis)theoretischen Positionen. Wenn man z.B. unterschiedliche Textanalysestrategien (siehe z.B. Titscher et al 1998) betrachtet, wir deutlich, dass diese mit unterschiedlichen theoretischen Grundkonzeptionen in Zusammenhang stehen - so etwa die Grounded Theory mit dem Pragmatismus, die Tiefenhermeneutik mit der Psychoanalyse, die Semiotik mit dem Strukturalismus oder die kritische Diskursanalyse mit der kritischen Theorie.
Eine weitere zentrale Frage ist natürlich, welche Arten von Daten analysiert werden sollen. Handelt es sich um numerisch quantitative Daten, für deren Analyse statistische Verfahren eingesetzt[1] werden, um Daten, die mittels spezifischer Interviewtechniken[2] (z.B. Analyse von Leitfadeninterviews [Schmidt 2000] oder narrativ- biographischer Interviews [Rosenthal et al 2000]) erhoben wurden, um visuelle Daten für die Methoden der Bild- und Filmanalyse eingesetzt werden müssen, um Dokumente (Wolff 2000) oder um Daten die im Rahmen einer längeren Feldforschung erhoben wurden und unterschiedliche Datanarten und Textsorten[3] umfassen.
Im Bereich der qualitativen Daten gibt es einerseits weit entwickelte und spezialisierte Auswertungsverfahren für bestimmte Datenerhebungsmethoden (z.B. Bildanalyseverfahren, Analyseverfahren für Leitfadeninterviews oder narrativ- biographische Interviews, etc.), andererseits existieren integrativere Datenanalysestrategien, die es erlauben, unterschiedliche Datenarten zu inkludieren und etwa im Rahmen der Analyse von Feldnotizen[4] oder der Grounded Theory zum Einsatz kommen. Insbesondere für die allgemeine Analyse von Feldforschungsdaten, welche ja immer unterschiedliche Datenarten umfasst sind integrative Datenanalysestrategien von Vorteil. Nicht nur für quantitative statistische Auswertungen sondern auch für qualitative Auswertungsstrategien stehen heute eine Reihe von Qualitativen Datenanalyseprogrammen (QDA) (z.B. Atlas.ti[5], MAXQDA[6], NVIVO[7] ) zur Verfügung (Kelle 2000).
Wenn nun in einem qualitativen Forschungsprojekt die Daten z.B. in verschriftlichter Form vorliegen (transkribierte Interviews, Feldnotizen, zu analysierende Dokumente oder Zeitungsausschnitte), so bieten sich immer noch zahlreiche Möglichkeiten, wie diese Texte analysiert werden können und vor allem 'auf welche der möglichen Ebenen die Analyse' abzielen soll. Diese Analysemöglichkeiten können z.B. anhand der Unterscheidung von Syntaktik, Semantik und Pragmatik veranschaulicht werden:
- Auf der syntaktischen Ebene geht es um die Beziehung zwischen den Zeichen. D.h. es handelt sich um eine formale Textanalyse, die einerseits im Sinne der Ethnolinguistik auf die grammatikalischen Strukturen (Phonetik, Lehre vom Satzbau etc.) und die Mittel der Zeichendarstellung abstellt, aber auch im Sinne einer AutorInnenanalyse den spezifischen Stil von KommunikatorInnen untersuchen kann.
- Auf der semantischen Ebene geht es um die Beziehung zwischen den Zeichen und dem Bezeichneten. Es steht also die Frage nach der Assoziation der Zeichen zu bestimmten Objekten, Ideen und Begriffen und ihrer Bedeutung im Zentrum. Unter diesem Aspekt würde man einen Text z.B. auf die in ihm vorkommenden Themen und ihre Bedeutung hin analysieren, wie es z.B. auch im Rahmen der interpretativen Anthropologie[8] der Fall ist.
- Auf der pragmatischen Ebene steht die Frage nach der Beziehung von Zeichen und ihren Benutzern sowie der Situation im Vordergrund. Es geht also um die Wirkung der Zeichen bzw. der Kommunikation in der sozialen Praxis. Hier können einerseits Bewertungsanalysen der Folgen und Wirkungen von Kommunikation durchgeführt werden, andererseits aber auch der Frage nach gegangen werden, wie mit Kommunikation Macht-, Ungleichheits- und Herrschaftsverhältnisse verschleiert, legitimiert und aufrecht erhalten werden können (z.B. kritische Diskursanalyse). Es geht also in diesen Ansätzen, die oft ein Naheverhältnis zur Soziolinguistik und zur linguistischen Anthropologie aufweisen, um Sprache als eine Form sozialer Praxis, oder - mit John Austin (1967) formuliert - um die Frage "how to do things with words".
Die konkreten methodischen Anweisungen, wie eine Analyse durchzuführen ist, unterscheiden sich je nach gewählter Strategie. Bisher liegen keine überzeugenden Systematisierungen der jeweiligen methodischen Anweisungen vor.
Viele Analysemethoden arbeiten mit einem Kode- Indikator-Modell. In dieser Logik werden einzelnen Datenausschnitten abstraktere Begrifflichkeiten (Kodes) zugeordnet und in weiterer Folge Beziehungen zwischen den Kodes entwickelt. Dies ist etwa im Rahmen der Grounded Theory, der qualitativen Inhaltsanalyse oder häufig bei der ethnographischen Analyse von Feldnotizen der Fall. Eine solche Analyse bricht die zeitliche Struktur der Ereignisse auf und verbindet entlang allgemeinerer Konzepte Daten miteinander, die von unterschiedlichen Beobachtungen und aus unterschiedlichen Kontexten stammen können.
Dem stehen Verfahren gegenüber, die sich am Ablauf bzw. der Abfolge von Ereignissen orientieren und davon ausgehen, dass ein adäquates Verständnis nur entlang der sequentiellen Abfolge der Ereignisse erreicht werden kann. Dazu gehört etwa das sequenzanalytische Vorgehen im Rahmen der objektiven Hermeneutik (Reichertz 2000), die Konversationsanalyse, welche unter anderem danach fragt, in wie weit in einem Dialog kommunikative Äußerungen sinnhafte soziale Ordnungen hervorbringen, absichern und die Handelnden sich wechselseitig aneinander orientieren. Innerhalb der Mythenanalyse sind hier syntagmatische[9], an der Ereignisstruktur des Mythos orientierte Analysestrategien (z.B. Propp), im Gegensatz zur paradigmatisch-strukturalistischen[10] Mythenanalyse von Claude Lévi-Strauss zu nennen. Die Unterscheidung zwischen am zeitlichen Ablauf orientierten Analysen und solchen, die primär synchron vorgehen reproduziert sich aber auch in unterschiedlichen Formen der Diskursanalyse[11].
Eine grundlegende Unterscheidung der Analyseverfahren besteht also darin, ob sie die Bedeutung sequentiell, aus dem was vorausgeht und dem was folgt ableiten bzw. rekonstruieren, oder aber nicht- sequentiell, ein Ereignis mit anderen Ereignissen bzw. Kontexten in Beziehung setzten und daraus allgemeine Aussagen zu gewinnen trachten.
Im Folgenden werden kurze Einführungen in die Möglichkeiten der Analyse von Feldnotizen und der qualitativen Inhaltsanalyse gegeben, sowie einige weitere ausgewählte Verfahren der Textanalyse kurz skizziert.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/quantitative/quantitative-titel.html
[2] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-38.html
[3] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-95.html
[4] Siehe Kapitel 6.1
[5] http://www.atlasti.com/
[6] http://www.maxqda.de/index.php
[7] http://www.qsrinternational.com//products_nvivo.aspx
[8] Siehe Kapitel
[9] http://www.lateinamerika-studien.at/content/kultur/mythen/mythen-411.html
[10] http://www.lateinamerika-studien.at/content/kultur/mythen/mythen-423.html
[11] Siehe Kapitel
6.1 Analyse der Fieldnotes
Neben der systematischen Datenerhebung empfiehlt es sich nach einiger Zeit - im Sinne einer Verschränkung von Datenerhebung und Datenanalyse[1] - analytische Phasen im Forschungsprozess vorzusehen. Auch bei längeren Feldforschungen sollte man Phasen des Rückzugs vom Feld einplanen und mit der Analyse der gesammelten Daten bereits vor Ort beginnen. Das heißt längere Feldforschungen sind nicht nur reine Datenerhebungszeiten, sondern inkludieren neben der systematischen Ausarbeitung der Feldnotizen auch deren erste Analyse.
Zu einer ersten Analyse der eigenen Feldnotizen gehört:
- das Lesen des gesamten Korpus der Aufzeichnungen[2]
- das Stellen von Fragen an die Fieldnotes[3]
- das Kodieren der Feldnotizen[4]
- das Verfassen von Memos[5]
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 4.2
[2] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-116.html
[3] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-117.html
[4] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-118.html
[5] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-125.html
6.2 Inhaltsanalyse
Bei der Inhaltsanalyse handelt es sich um eine Textanalysemethode, die ursprünglich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in den USA zur Analyse von Massenmedien entwickelt wurde. Diese hat sich primär auf quantifizierbare Aspekte von Textinhalten (quantitative Inhaltsanalyse) bezogen, erst später wurden auch Verfahren zur Durchführung qualitativer Inhaltsanalysen entwickelt. Insgesamt fokussiert die Inhaltsanalyse auf manifeste Kommunikationsinhalte, mit dem Ziel von den Textmerkmalen auf den Kontext (auf den Autor, die Situation bzw. die Rezipienten) zu schließen.
6.2.1 quantitative Inhaltsanalyse
Die Entwicklung der quantitativen Inhaltsanalyse steht wesentlich im Zusammenhang mit der Entwicklung der modernen Massenkommunikationsmedien wie Zeitung und Fernsehen. Die forschungsleitende Frage ist dabei "Wer sagt was zu wem mit welcher Wirkung?". Ziel ist es dabei, Aussagen über die Verfasser der Nachricht, die Empfänger derselben, sowie die Wirkung bzw. Rezeption der Kommunikation zu erforschen. "Am Beginn inhaltsanalytischer Forschung stand zweifelsohne ein einfaches, behavioristisch orientiertes Reiz- Reaktions-Modell der Kommunikation, welches eine asymmetrische Beziehung zwischen Sender, Stimulus und Rezipient konstruiert." (Titscher et al. 1998: 76) Um diese kausal konzipierten Zusammenhänge der Beeinflussung der Rezipienten mittels Nachrichten zu erforschen, werden innerhalb der quantitativen Inhaltsanalyse die Kommunikationsinhalte möglichst präzise gemessen. Diese Messung bezieht sich zum Beispiel auf die Häufigkeit von Wörtern pro Text oder die Größe von Texten in Zeitschriften. Dieses Auszählen, Bewerten und In-Beziehung-Setzen von Textelementen spielte insbesondere auch eine zentrale Rolle in der politischen Propagandaforschung.
Ein zentrales Moment jeder Inhaltsanalyse ist ihr Kategoriensystem, mit dessen Hilfe jede Analyseeinheit kodiert werden muss. Diese Kategorien werden mit Hilfe operationaler Definitionen[1] von Variablen, also a priori auf deduktivistische Weise[2] festgelegt. Das heißt, das Kategoriensystem wird im Unterschied zur Ethnographie, zur Grounded Theory, aber auch zur qualitativen Inhaltsanalyse bereits im Vorfeld der Untersuchung ausgearbeitet. Nach dem Kodieren werden mittels quantitativer Verfahren Häufigkeiten und Zusammenhänge zwischen einzelnen Variablen berechnet. Lamnek (2005: 505) nennt unterschiedliche Formen der quantitativen Inhaltsanalyse, wie zum Beispiel die Frequenzanalyse, die Dokumentenanalyse, die Valenzanalyse, die Intensitätsanalyse, die Kontingenzanalyse und die Bedeutungsfeldanalyse. Für eine Darstellung der unterschiedlichen inhaltsanalytischen Verfahren und Analyseebenen (syntaktisch, semantisch, pragmatisch) siehe Merten (1983).
Die quantitative Inhaltsanalyse wurde dahingehend kritisiert, dass sie folgende vier Dimensionen zu wenig berücksichtige:
- "den Kontext von Textbestandteilen
- latente Sinnstrukturen
- markante Einzelfälle
- das, was im Text nicht vorkommt" (Mayring 2002: 114).
Aus dieser Kritik entwickelte sich die qualitative Inhaltsanalyse.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 2.7.1.1
[2] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-6.html
6.2.2 qualitative Inhaltsanalyse
Die qualitative Inhaltsanalyse wurde in kritischer Abgrenzung zur quantitativen Inhaltsanalyse entwickelt. Innerhalb des deutschsprachigen Raums steht die qualitative Inhaltsanalyse insbesondere mit dem von Philipp Mayring entwickelten Verfahren in Zusammenhang. Mayring zu Folge ist der Anspruch der qualitativen Inhaltsanalyse folgender: Sie "will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriesystemen bearbeitet" (Mayring 2002: 114). Mayring konzipiert ein allgemeines Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse, welches er wie folgt veranschaulicht:
Abbildung: inhaltsanalytisches AblaufmodellAbbildung: allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell nach Mayring (1988: 49)
Im Zentrum des qualitativen inhaltsanalytischen Vorgehens steht also die Entwicklung eines Kategoriensystems, welches in einem Wechselverhältnis zwischen Theorie (der Fragestellung) und dem konkreten Material entwickelt wird. Die Kategorisierungsdimensionen und das Abstraktionsniveau werden jedoch vorab festgelegt und mit theoretischen Erwägungen und dem Ziel der Analyse begründet (Mayring 2002: 115f). Innerhalb dieser Festlegungen wird das konkrete Kategoriensystem an Hand des vorliegenden Materials entwickelt.
Im Weiteren unterscheidet Mayring drei verschiedene inhaltsanalytische Analyseverfahren: die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung.
6.2.2.1 Zusammenfassende Inhaltsanalyse
Abbildung: zusammenfassende InhaltsanalyseAbbildung: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse nach Mayring (1988: 55)
Ziel der zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist es, "das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben [und] durch Abstraktion ein überschaubares Corpus zu schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist" (Mayring 1988: 53; 2002: 115).
Die inhaltsanalytische Zusammenfassung spielt auch eine wichtige Rolle bei der induktiven[1] Kategorienbildung. Dabei werden nicht nur wie beim offenen Codieren[2] abstrakte Konzepte mit Textstellen verbunden, sondern Kategorien mittels Paraphrasen, Generalisierungen und Reduktionen erarbeitet, wie es auch im folgenden Ablaufmodell der zusammenfassenden Inhaltsanalyse zum Ausdruck kommt.
Folgende tabellarische Aufstellung veranschaulicht das Verhältnis von Paraphrase, Generalisierung und den mittels Reduktion (Streichungen) gewonnenen Kategorien, die Teil des zu entwickelnden Kategoriensystems sind und für die weiteren Formen der Inhaltsanalyse genutzt werden.
Im Rahmen des folgenden Beispiels wurde das Abstraktionsniveau des Reduktionsdurchganges wie folgt festgelegt: "Es sollten möglichst allgemeine aber fallspezifische (pro Lehrer) Äußerungen über die Referendarzeit sein." (Mayring 1988: 58) In der mittleren Hauptspalte werden die einzelnen Paraphrasen auf dieses Abstraktionsniveau hin generalisiert. Doppelte oder unwichtige Äußerungen werden gestrichen und in der letzen Spalte werden Kategorien genannt, die aus den übrig gebliebenen Äußerungen "durch Bündelung, Integration und Konstruktion zu neuen Äußerungen fallspezifisch zusammengestellt" (ebd.) wurden.
Abbildung: Beispiel ReduktionsdurchgangAbbildung: Beispiel für einen Reduktionsdurchgang im Rahmen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse (aus Mayring 1988: 59)
Die Reduktionsschritte im Rahmen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse lassen sich wie folgt veranschaulichen:
Abbildung: MaterialreduzierungAbbildung: Materialreduzierung durch die Zusammenfassung (aus Mayring 1988: 68)
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-5.html
[2] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-119.html
6.2.2.2 Explikative Inhaltsanalyse
Abbildung: explizierende InhaltsanalyseAbbildung: Ablaufmodell explizierender Inhaltsanalyse nach Mayring 1988: 70
Ziel der explikativen Inhaltsanalyse "ist es, zu einzelnen fraglichen Textteilen (Begriffen, Sätzen, ...) zusätzliches Material heranzutragen, das das Verständnis erweitert, das die Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet" (Mayring 1988: 53; 2002: 115). Dafür muss festgelegt werden, wo nach zusätzlichem Material gesucht wird, um fragliche Textstellen zu explizieren.
Mayring unterscheidet hier eine "engen" Textkontext und versteht darunter das direkte Textumfeld der interpretationsbedürftigen Textstelle und einen "weiten" Textkontext, welcher über den Text hinausgehende Informationen über den Autor, Adressaten, Interpreten, kulturelles Umfeld, etc. umfassen können (Mayring 2002: 117f). Mayring versteht die Explikation auch als Kontextanalyse der fraglichen Textteile.
Ziel dieser Analyse ist die Formulierung so genannter explifizierender Paraphrasen, welche Formulierungen beinhalten, die die fragliche Textstelle erklären. Diese entstehen "im Allgemeinen dadurch, dass das gesammelte Material zusammengefasst wird (...). Wenn jedoch Widersprüche im Material auftauchen, müssen alternative Paraphrasen formuliert werden" Mayring 1988: 71).
Im letzten Schritt der explikativen Inhaltsanalyse muss im Gesamtzusammenhang überprüft werden, ob eine sinnvolle Explikation erreicht wurde, falls dies nicht der Fall ist, muss neues und zusätzliches Material herangezogen werden. Insgesamt ergibt sich daraus folgendes Ablaufmodell der explizierenden Inhaltsanalyse.
6.2.2.3 Strukturierende Inhaltsanalyse
Ziel der strukturierenden Inhaltsanalyse ist es, "eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Das können formale Aspekte, inhaltliche Aspekte oder bestimmte Typen sein; es kann aber auch eine Skalierung, eine Einschätzung auf bestimmten Dimensionen angestrebt werden (Mayring 2002: 118). Diese Form der Analyse geht vom erstellten Kategoriensystem aus und legt in einem ersten Schritt der Definition der Kategorien fest, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen. In einem zweiten Schritt identifiziert es an Hand konkreter Textstellen Ankerbeispiele für die jeweilige Kategorie und drittens werden Codierregeln formuliert, welche eindeutige Zuordnungen zwischen den einzelnen Kategorien ermöglichen.
Abbildung: strukturierte InhaltsanalyseAbbildung: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse nach Mayring 1988: 77; 2002: 120)
Mayring betrachtet dieses Modell allerdings als zu allgemein und unterscheidet verschiedene Formen der Strukturierung, die unterschiedlichen Zielen folgen.
- Die formale Strukturierung will die innere Struktur des Materials nach formalen Strukturierungsgesichtspunkten herausfiltern. Dabei ist es notwendig das Kriterium der Strukturierung, nach dem der Text analysiert werden soll, im Vorfeld genau zu bestimmen. Mayring (1988: 78f) unterscheidet folgende vier Arten von Kriterien:
- syntaktische Kriterien, die die Struktur der sprachlichen Formulierungen, z.B. Besonderheiten im Satzbau, Abweichungen, Brücken etc. aufdecken wollen,
- thematische Kriterien, welche die inhaltliche Struktur, die thematische Abfolge und inhaltliche Gliederung sichtbar machen,
- semantische Kriterien, die die Beziehung zwischen einzelnen Bedeutungseinheiten, etwa im Sinn eines semantischen Netzwerkes, rekonstruieren
- und dialogische Kriterien, welche die Abfolge einzelner Gesprächsbeiträge und Gesprächsschritte analysieren.
- Die inhaltliche Strukturierung will Material zu bestimmten Themen und Inhaltsbereichen extrahieren und zusammenfassen.
- Die typisierende Strukturierung will auf einer Typisierungsdimension einzelne markante Ausprägungen im Material finden und diese genauer beschreiben.
- Die skalierende Strukturierung will zu einzelnen Dimensionen Ausprägungen in Form von Skalenpunkten definieren.
Insgesamt beruht die strukturierende Inhaltsanalyse auf drei zentralen Schritten:
1) Die Definition der Kategorien, wobei explizit definiert wird, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen.
2) Die Identifikation von Ankerbeispielen für die jeweilige Kategorie.
3) Die Festlegung von Kodierregeln, um eindeutige Zuordnungen bei Abgrenzungsproblemen zwischen Kategorien zu ermöglichen. (Mayring 2002: 118f)
Diese Regeln werden in einem Kodierleitfaden zusammengefasst.
Die strukturierende Inhaltsanalyse eignet sich insbesondere für die theoriegeleitete Analyse von Textmaterial.
6.3 weitere ausgewählte Verfahren der Textanalyse
Neben den zur Analyse der Feldnotizen[1] angewandten Kodierstrategien werden auch innerhalb der Ethnographie unterschiedliche Traditionen der Textanalyse angewandt. Dazu gehören z.B.
- struktural semiotische Analysen, welche insbesondere der Analyse von Narrationen, Mythen und Märchen dient (Vladimir Propp, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes) und
- die auf John Austins Theorie der Sprechakte zurückgehende Ethnographie des Sprechens (z.B. Dell Hymes, John Gumperz) im Rahmen einer linguistischen Anthropologie,
- aber auch diskursanalytische und konversationsanalytische Verfahren.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 6.1
6.3.1 Strukturale Semiotik
Unter strukturaler Semiotik fallen eine Reihe von Analysemethoden, die sich auf Theoriekonzeptionen der Semiotik (die allgemeine Lehre von den Zeichen, Zeichensystemen und Zeichenprozessen) und des Strukturalismus beziehen.
Zu den Wegbereitern gehören der US-Amerikaner Charles Sanders Peirce (1839 - 1914), der Schweizer Linguist Ferdinand de Saussure (1857 - 1913), der russische Folklorist Vladimir Propp (1895 - 1970), der französische Strukturalist Claude Lévi- Strauss (geb. 1908) sowie der poststrukturalistische Philosoph und Literaturkritiker Roland Barthes (1915 - 1980).
Innerhalb der Kultur- und Sozialanthropologie wurden diese Verfahren insbesondere zur Analyse standardisierter Erzählformen, wie Mythen und Märchen[1], eingesetzt.
Roland Barthes hat die strukturale Semiotik weiterentwickelt und u.a. auch auf moderne Mythen des Alltags (1967) angewandt (vgl. Mader 2008: 174ff).
Die beiden klassischen Verfahren der strukturellen kulturanthropologischen Mythenanalyse wurden von Vladimir Propp und Claude Lévi-Strauss entwickelt. Während Vladimir Propp’s syntagmatische Mythenanalyse[2] primär am sequentiellen Handlungsablauf der Erzählung und der in ihr vorkommenden Akteure interessiert ist, fokussiert die paradigmatische Mythenanalyse[3] von Claude Lévi- Strauss auf allgemeine Regelsysteme des menschlichen Denkens, welche u.a. in strukturellen Oppositionspaaren zum Ausdruck kommen und die sich auch in den mythischen Erzählungen realisieren. Es stehen hier die Strukturen des menschlichen Denkens im Zentrum und nicht der sequentielle Handlungsablauf einer Erzählung.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.lateinamerika-studien.at/content/kultur/mythen/mythen-18.html
[2] http://www.lateinamerika-studien.at/content/kultur/mythen/mythen-413.html
[3] http://www.lateinamerika-studien.at/content/kultur/mythen/mythen-411.html
6.3.2 Ethnographie des Sprechens - linguistische Anthropologie
Die Ethnographie des Sprechens wurde als Teil der linguistischen Anthropologie von Dell Hymes (geb. 1927) entwickelt. Diese baut auf John Austins (1911-1960) Theorie der Sprechakte auf und versteht die linguistische Anthropologie als einen Teilbereich der Kulturanthropologie, im Gegensatz zur Ethnolingusitik bzw. der anthropologischen Linguistik, welche sich primär an Methoden und Theorien der Linguistik orientieren.
Insgesamt werden in der Ethnographie des Sprechens die Kommunikationsmuster als Teil kulturellen Wissens und Verhaltens verstanden. Es geht also nicht um die strukturalen Aspekte standardisierter Erzählungen, sondern um die soziokulturelle Dimension der Sprechakte. Die Betonung liegt auf der deskriptiv-ethnographischen Dokumentation der Sprachverwendung und der Beschreibung von Sprechweisen, die das soziale Leben bestimmter Sprachgemeinschaften (speech-communities) konstituieren und reflektieren. Es geht darum, Sprechakte innerhalb von Einflussbeziehungen, d.h. im Rahmen der Struktur des sozialen Verhaltens (die Sprechsituation, der Äußerungskontext), zu verorten, wobei die kommunikative Kompetenz der SprecherInnen eine zentrale Rolle spielt.
Zu den zentralen Fragestellungen gehören, welche Sprechmuster in welchen gesellschaftlichen Kontexten verfügbar sind und wie, wo und wann sie ins Spiel kommen. Wer spricht mit wem, wann und wo, in welchem Stil und in welchem Sprachcode über welche Angelegenheit? Die wichtigsten Analyseeinheiten sind Sprechsituationen, Sprechereignisse und Sprechakte, wobei Sprechakte innerhalb kulturell spezifischer Sprechereignisse analysiert werden und die Analyse des soziokulturellen Kontextes ein Kernbestandteil der Methode ist.
Die linguistische Anthropologie ist insbesondere innerhalb der US-amerikanischen Anthropologie verankert. Zu den wichtigsten Vertretern gehören u.a. AutorInnen wie John Gumperz, Joel Sherzer, Greg Urban, Ellen Basso und Bambi Schieffelin.
6.3.3 Diskurs- und konverstationsanalytische Verfahren
Unter den Begriffen diskurs- und konversationsanalytische Verfahren werden eine ganze Reihe sowohl methodisch, wie theoretisch unterschiedlich ausgerichteter Techniken subsumiert. Insbesondere der Begriff der Diskursanalyse umfasst kein einheitliches und klar definiertes Feld. Dies liegt unter anderem daran, dass bereits der Begriff des Diskurses selbst unterschiedlich verstanden werden kann.
So findet etwa im Rahmen der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule ein normativer Diskursbegriff Verwendung, der einen herrschaftsfreien Diskurs der gleichberechtigten Aushandlung ins Zentrum stellt.
Im Gegensatz dazu fokussiert die US-amerikanische ethnomethodologische Tradition (Garfinkel) in ihrem Diskursbegriff auf den Ablauf, die Themenorganisation und die Rollen in face- to-face-Gesprächen. Diese Mikro-Analysen von interpersonellen Gesprächen werden in der Literatur im Gegensatz zur Diskursanalyse als Konversationsanalyse bezeichnet. Für eine ethnographische Anwendung der Konversationsanalyse siehe etwa Moerman (1988).
Der (post)strukturalistische Diskursbegriff, in Anschluss an Foucault, stellt hingegen die Frage, wie gesellschaftliche Interaktion Gegenstände, Themen, Begriffe etc. konsituiert und wie sich diese, im Sinne einer historischen Diskursanalyse, im Laufe der Zeit verändern.
Nicht-diachron-historische sondern synchrone Weiterentwicklungen der Diskursanalyse stellen die unterschiedlichen Ansätze der so genannten kritischen Diskursanalyse dar. Diese beziehen sich neben Michel Foucault insbesondere auf Theorien von Antonio Gramsci und der Frankfurter Schule, d.h. des Neomarxismus.
6.3.3.1 historische Diskursanalyse
Die historische Diskursanalyse geht auf Foucault zurück und beschäftigt sich mit Diskursformationen, die unterschiedliche Texte durchziehen. Es geht im Unterschied zur Hermeneutik[1] nicht darum, einen Text in seiner Ganzheit zu verstehen und zu interpretieren, sondern darum, wie gesellschaftliche Interaktion Gegenständen, Themen, Begriffen etc. konsituiert und wie sich diese, im Sinne einer "Archäologie des Wissens", im Laufe der Zeit verändern.
Zentrale Fragestellungen sind
- die kommunikative Konstitution von Wirklichkeit,
- Veränderungen dieser Wirklichkeitskonstruktionen,
- das soziale Wissen bestimmter Gruppen oder der Gesamtgesellschaft
- diskursive Machtwirkungen: Was darf gesagt werden? Was darf nicht gesagt werden?
Der Diskurs im Sinne Foucaults trägt dazu bei, Gesellschaft zu konstituieren und er legt die Möglichkeiten des Sagbaren fest. D.h. Diskurse konstituieren gleichzeitig Ausschließungsmechanismen in Form von Verboten, Grenzziehungen, Theorien, Doktrinen und Ritualen, welche das Sagbare unter gewissen sozialen und historischen Bedingungen eingrenzen. Unter solchen Bedingungen, die Foucault Möglichkeitsbedingungen nennt, werden jeweils nur bestimmte Dinge als wahr angenommen und diese wirken prägend auf zukünftige diskursive Ereignisse. Foucault geht es um die Rekonstruktion dieser diskursiven Voraussetzungen und deren Transformationen.
Dabei unterscheidet er zwischen Ereignissen (spontane Elemente in einer Äußerung), die zu Serien (Keimzellen diskursiver Formationen) werden können. Durch die Verdichtung von Serien können neue diskursive Strukturen mit spezifischer Regelhaftigkeit entstehen, die selbst wieder Möglichkeitsbedingungen des Sagbaren konstituieren.
Weiterführende Literatur:
Foucault, Michel (1973): Die Archäologie des Wissens. Suhrkamp, Frankfurt am Main.
Foucault, Michel (1976): Überwachen und Strafen. Suhrkamp, Frankfurt am Main.
Foucault, Michel (1989): Sexualität und Wahrheit. Suhrkamp, Frankfurt am Main. 3 Bände.
Foucault, Michel (1991 [1970]): Die Ordnung der Diskurse. Fischer, Frankfurt am Main.
http://evakreisky.at/onlinetexte/nachlese_diskurs.php[2]
Verweise in diesem Kapitel:
[1] Siehe Kapitel 2.3.1
[2] http://evakreisky.at/onlinetexte/nachlese_diskurs.php
6.3.3.2 kritische Diskursanalyse
So wie unter der Diskursanalyse an sich ist auch bei der kritischen Diskursanalyse (KDA) keine einheitliche und homogene Methode zu verstehen, vielmehr werden unter diesem Begriff unterschiedliche Verfahren subsumiert. Neben Michel Foucault stellen insbesondere Antonio Gramsci und die Frankfurter Schule, d.h. der Neomarxismus, den theoretischen Hintergrund der kritischen Diskursanalyse dar.
Wodak veranschaulicht die allgemeinen Prinzipien der kritischen Diskursanalyse in acht Punkten (1996: 17-20), die wie folgt zusammengefasst werden können:
- Die kritische Diskursanalyse beschäftigt sich mit sozialen Problemen und nicht mit Sprache oder Sprachgebrauch per se. Im Zentrum steht der linguistische Charakter sozialer und kultureller Prozesse und Strukturen.
- Die KDA untersucht diskursiv konstituierte Machtbeziehungen in Diskursen als auch Macht über den Diskurs.
- Gesellschaft und Kultur werden einerseits diskursiv geschaffen und konstituieren andererseits in einem dialektischen Verhältnis den Diskurs. Sprachgebrauch reproduziert/transformiert Gesellschaft und Kultur sowie die Machtbeziehungen.
- Sprachgebrauch kann ideologisch sein.
- Diskurse sind historisch und nur kontextuell/situativ zu verstehen.
- Die Verbindung zwischen Text und Gesellschaft wird mittels eines soziopsychologischen Modells des Textverstehens erklärt, welches als Vermittlungsinstanz dient.
- Diskursanalyse versteht sich sowohl als interpretativ wie auch erklärend.
- Diskurs wird als Form sozialer Handlung konzipiert und die kritische Diskursanalyse versteht sich als sozialwissenschaftliche Richtung.
"Die Zielsetzung der kritischen Diskursanalyse ist es die meist nicht bewusste gegenseitige Beeinflussung von Sprache und sozialer Struktur bewusst zu machen" (Titscher et al. 1998: 181). Dies geschieht z.B. im Rahmen der Vorurteilsforschung (Rassismus, Sexismus), des Sprachgebrauchs in Organisationen, etc.
6.3.3.3 Einige methodische Anweisungen
Ganz allgemein formuliert beruht die Durchführung einer Diskursanalyse[1] auf der Festlegung einer Fragestellung (des zu untersuchenden Diskursthemas) und des den Diskurs konstituierenden Praxisfeldes (z.B. zentrale Akteure, Medien, Institutionen).
Auf Basis dieser Voraussetzung wird der zu untersuchende Textkorpus anhand von Schlüsselwörtern des Themas und damit verbundenen Inhaltsaspekten festgelegt und begründet. Es handelt sich dabei um eine explizite und begründete Auswahl und Begrenzung des Korpus, entlang von zentralen Akteuren, wichtigen Medien und Institutionen, innerhalb eines gewählten Untersuchungszeitraums und nicht um ein repräsentatives Sample[2] im statistischen Sinne.
So ein Korpus kann mittels unterschiedlicher Strategien analysiert werden.
Verweise in diesem Kapitel:
[1] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/ksamethoden/ksamethoden-98.html
[2] http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-8.html
6.3.3.3.1 Grob- und Feinanalysen
Im Allgemeinen kann man zwischen Grob- und Feinanalyse unterscheiden.
Die Grobanalyse kann sich sowohl auf die Abfolge des Diskurses (diachron), als auch auf bestimmte Inhalte und Positionen (synchron) beziehen.
Bei der Abfolge des Diskurses stehen die thematischen Diskursstränge und ihre unterschiedlichen Ebenen im Zentrum der Aufmerksamkeit, sowie die unterschiedlichen Phasen und Sequenzen in der Diskursabfolge.
Bei der synchronen Analyse geht es um die Rekonstruktion unterschiedlicher Positionen an Hand von Streitfragen, konkurrierenden Auffassungen, Auslassungen sowie häufig vorkommenden Allgemeinpositionen.
Neben einer solchen Grobanalyse existieren eine Reihe unterschiedlicher Anweisungen zur Durchführung diskursanalytischer Feinanalysen (siehe z.B. unterschiedliche Strategien der kritischen Diskursanalyse in Titscher et al. 1998: 182ff; Jäger 2004). Im Folgenden werden einige ausgewählte Aspekte genannt, auf die sich solche Feinanalysen beziehen können, ohne damit jedoch den Anspruch zu verbinden hier deren methodische Umsetzung vermitteln zu können.
Auf der Textebene kann nach Inhalt und Form (der Organisation) des Textes gefragt werden. Dazu gehören sowohl linguistische Aspekte des Textes (Phonologie, Grammatik, Vokabular, Semantik) aber auch die Textorganisation, d.h. die Makrostruktur des Textes und bestimmter Textgattungen.
Auf der Ebene der argumentativen bzw. diskursiven Praxis stehen z.B. Fragen nach
- den Diskursen der Differenz (Wir/Sie- Diskurs) und deren sprachliche Realisierung,
- den Strategien und Techniken der Argumentation, Rechtfertigung und Beschuldigung (Schwarz/Weiß-Malerei, Opfer/Täter-Umkehr, Abschieben von Schuld etc.),
- sowie den Formen der Versprachlichung auf Textebene (Vergleiche, Zitate, irreale Szenarien etc.), Satzebene (rhetorische Fragen, Anspielungen, Metaphern etc.) und Wortebene (Vagheiten, Verharmlosungen etc.)
im Zentrum.
Auf der Ebene der sozialen Praxis steht das Verständnis des Kontextes des Diskurses, sowie die Konfrontation der getätigten Aussagen mit überprüfbaren Daten und Fakten im Zentrum der Analyse, welche die Spezifität und Selektivität der Aussagen deutlich machen soll.
6.4 Literatur
Austin, John
1967: How to do things with words. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
Barthes, Roland
1964: Mythen des Alltags. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main.
Blommaert, Jan
2000: Critical Discourse Analysis. Annual Review of Anthropology Vol. 29: S. 447-466.
Flick, Uwe; von Kardorff, Ernst; Steinke, Ines (Hg.)
2000: Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg
Goodwin, Charles & John Heritage
1990: Conversation Analysis. Annual Review of Anthropology Vol. 19: S. 283-307.
Jäger, Siegfried
2004: Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung. Edition DISS, Münster.
Kelle, Udo
2000: Computergestützte Analyse qualitativer Daten. In: Flick, Uwe et al. (Hg.) Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg: S. 485-502.
Lamnek, Siegfried
2005: Qualitative Sozialforschung. Beltz PVU, Weinheim, Basel.
Lévi-Strauss, Claude
1964-1971: Mythologica I-IV. Suhrkamp, Frankfurt/Main.
1967/1984: „The Story of Asdiwal“. In: Dundes, Alan (Hg.) Sacred Narrative. Readings in the Theory of Myth. University of California Press, London.
Mader, Elke
2008: Anthropologie der Mythen. facultas.wuv, Wien.
Mayring, Philipp
1988: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Deutscher Studienverlag, Weinheim.
2002: Einführung in die qualitative Sozialforschung. Beltz Verlag, Weinheim.
Merten, Klaus
1983: Inhaltsanalyse. Einführung in Theorie, Methode und Praxis. Westdeutscher Verlag: Opladen.
Moerman, Michael
1988: Talking Culture. Ethnography and Conversation Analysis. University of Pennsylvania Press: Philadelphia.
Propp, Vladimir
1968: Morphology of the Folktale. University of Texas Press, Austin.
Reichertz, Jo
2000: Objektive Hermeneutik und hermeneutische Wissenssoziologie. In: Flick, Uwe et al (Hg.) Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Rowohlt: Reinbeck bei Hamburg. S. 514 - 524.
Rosenthal, Gabriele; Fischer-Rosenthal, Wolfram
2000: Analyse narrativ- biographischer Interviews. In: Flick, Uwe et al. (Hg.) Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg: S. 456-468.
Schmidt, Christiane
2000: Analyse von Leitfadeninterviews. In: Flick, Uwe et al (Hg.) Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg: S. 447-456.
Titscher, Stefan; Ruth Wodak, Michael Meyer und Eva Vetterl
1998: Methoden der Textanalyse. Westdeutscher Verlag, Opladen.
Wolff, Stephan
2000: Dokumenten- und Aktenanalyse. In: Flick, Uwe et al. (Hg.) Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg: S. 502-513.
</div>
</div>