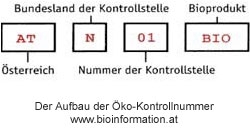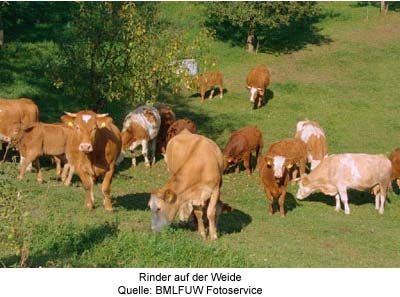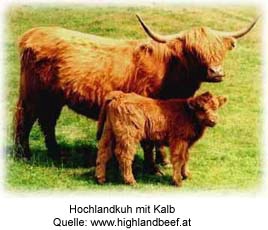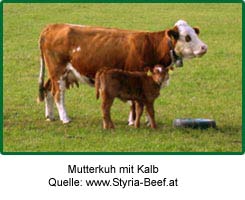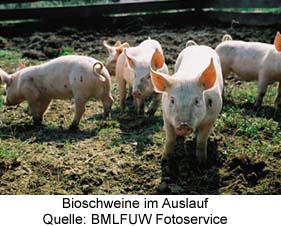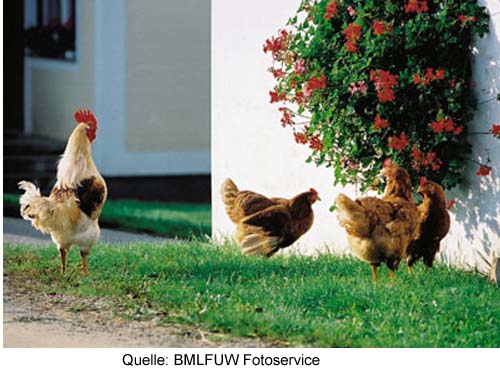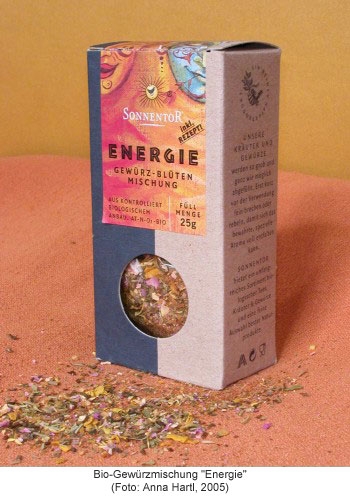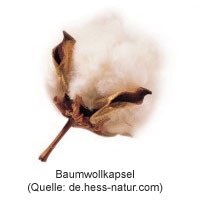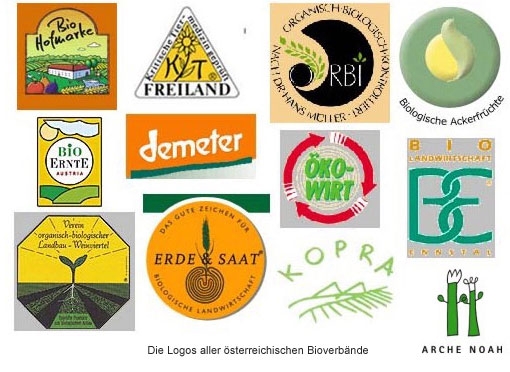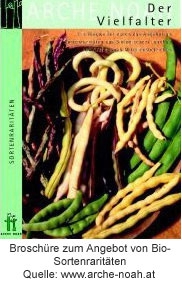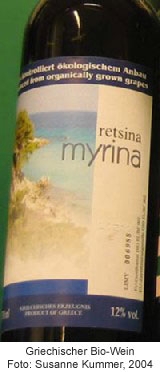Biologische Landwirtschaft und Markt
Contents
- 1 Biologische Landwirtschaft und Markt
- 2 1 Was ist Biologische Landwirtschaft?
- 3 2 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 4 2.1 Verordnung (EWG) 2092/91
- 5 2.2 Lebensmittel Codex A.8.
- 6 2.3 Privatrechtliche Regelungen für Biolandbau
- 7 2.4 Kontrolle und Zertifizierung
- 8 3 Gründerväter
- 9 3.1 Rudolf Steiner
- 10 3.2 Hans und Maria Müller und Dr. Rusch
- 11 3.3 Gerhard Plakolm und Alfred Haiger
- 12 3.4 Karl Wlaschek und Werner Lampert
- 13 4 Produktpalette
- 14 4.1 Produkte tierischer Herkunft
- 14.1 Inhalt
- 14.2 4.1.1 Richtlinien für Tiere und tierische Erzeugnisse
- 14.3 4.1.2 Rindfleisch
- 14.4 4.1.2.1 Absatz und Vermarktung
- 14.5 4.1.2.2 Marken
- 14.6 4.1.2.2.1 Highlandbeef
- 14.7 4.1.2.2.2 Styria Beef
- 14.8 4.1.2.3 Mutterkuhhaltung
- 14.9 4.1.2.4 Fleischkategorien
- 14.10 4.1.3 Schweinefleisch
- 14.11 4.1.3.1 Entwicklung der Bio-Schweinehaltung
- 14.12 4.1.3.2 Vermarktung
- 14.13 4.1.3.3 Freilandschweine
- 14.14 4.1.4 Huhn und Ei
- 14.15 4.1.5 Fisch
- 14.16 4.1.6 Milch und Milchprodukte
- 15 4.2 Produkte pflanzlicher Herkunft
- 15.1 Inhalt
- 15.2 4.2.1 Gemüse
- 15.3 4.2.1.1 Kategorien
- 15.4 4.2.1.2 Betriebe
- 15.5 4.2.1.3 Vermarktung
- 15.6 4.2.1.4 Problembereiche
- 15.7 4.2.2 Obst
- 15.8 4.2.2.1 Betriebe
- 15.9 4.2.2.2 Vermarktung
- 15.10 4.2.2.3 Problembereiche
- 15.11 4.2.3 Getreide und -produkte
- 15.12 4.2.4 Getränke
- 15.13 4.2.5 Kräuter und Gewürze
- 15.14 4.2.6 Speiseöle
- 16 4.3 Convenience-Produkte
- 17 4.4 Non-Food-Produkte
- 17.1 Inhalt
- 17.2 4.4.1 Naturkosmetik
- 17.3 4.4.1.1 Rohstoffe
- 17.4 4.4.1.2 Produkte und Hersteller
- 17.5 4.4.1.3 Vermarktung
- 17.6 4.4.1.4 Richtlinien für Naturkosmetik
- 17.7 4.4.1.4.1 Österreichischer Lebensmittelcodex
- 17.8 4.4.1.4.2 "Kontrollierte Naturkosmetik" - eine privatrechtliche Richtlinie
- 17.9 4.4.2 Naturtextilien
- 17.10 4.4.2.1 Rohstoffe
- 17.11 4.4.2.1.1 Pflanzenfarben
- 17.12 4.4.2.1.2 Bio-Baumwolle
- 17.13 4.4.2.2 Produkte und Hersteller
- 17.14 4.4.2.3 Vermarktung
- 17.15 4.4.2.4 Richtlinien für Naturtextilien
- 18 5 Vermarktungsformen
- 19 5.1 Entwicklung der Vermarktung
- 20 5.2 Supermärkte
- 21 5.3 Naturkostläden
- 22 5.4 Direktvermarktung
- 23 5.5 Internet Shopping
- 24 5.6 Hauszustellung
- 25 5.7 Selbsternte
- 26 6 Gastronomie und Grossküchen
- 27 6.1 Entwicklung
- 28 6.2 Ansprüche der Großküchen
- 29 6.3 Lieferanten für Großküchen
- 30 6.4 Bio-Hotels
- 31 6.5 Biorestaurants
- 32 6.6 Gemeinschaftsverpflegung
- 33 7 Erzeuger
- 34 7.1 Der Blick auf Bio-Bauernhöfe Österreichs
- 35 7.2 Der Blick auf Bio-Erzeugergemeinschaften
- 36 8 Aufbereiter (Verarbeiter)
- 37 9 Bioverbände
- 38 9.1 Bioverbände in Österreich
- 39 9.2 IFOAM- der internationale Dachverband
- 40 10 Konsumenteninformation
- 41 11 Aktuelle Entwicklungen
- 42 11.1 Sortenraritäten
- 43 11.2 Fair Trade und Biolandbau
- 44 11.3 Bioregionen
- 45 11.4 Politik und Meinungsbildung
- 46 12 Diskussionsfelder
- 47 12.1 Regional versus Global im Biolandbau
- 48 12.2 Externe Effekte der Landwirtschaft
- 49 12.3 Wertewandel
- 50 12.4 Unternehmertum - Verunternehmerisierung
- 51 12.5 Wettbewerb - Preise
- 52 13 Glossar
- 53 13.1 Biologische Landwirtschaft
- 54 13.2 Pflanzenschutzmittel
- 55 13.3 Ökologischer Landbau
- 56 13.4 ÖPUL
- 57 13.5 AMA
- 58 13.6 Fruchtfolge
- 59 13.7 Bioverband
- 60 13.8 Erzeuger
- 61 13.9 Kontrolle
- 62 13.10 Zertifizierung
- 63 14 Quellen
- 64 14.1 Internetseiten
Biologische Landwirtschaft und Markt
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
OEKU-Online: Finanziert durch den Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (Projekt 10707, Jubiläumsfonds).
Supermarktketten, der fahrende Händler mit Äpfeln vor der Haustür, die Bäuerin am Markt: Sie und viele andere werben für Produkte aus Biologischer Landwirtschaft.
Aber, was ist biologische Landwirtschaft?
Biologische Landwirtschaft ist eine umweltschonende und sozialverträgliche neue Form der Landbewirtschaftung, die zweifelsfrei gesetzlich geregelt ist und deren Produkte eindeutig gekennzeichnet werden müssen. Die Produktpalette umfaßt alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse des täglichen Bedarfs, die von einer grossen Vielfalt von Erzeugern und Verarbeiter hergestellt, sowie über verschiedene Wege von verschiedenen Vermarktungsformen an die KonsumentInnen, aber auch an Gastronomie und Grossküchen gebracht werden. Unterstützt wird die Vermarktung durch Konsumenteninformation und Bioverbände. Die Arbeit der Gründerväter und aktuelle Entwicklungen führen dazu, dass nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kosmetika, Textilien , Hotelurlaube und Restaurantbesuche nach den Richtlinien des Biologischen Landbaus angeboten werden. Die dynamische Entwicklung des Biolandbaus der vergangenen Jahre hat jedoch nicht nur Zufriedenheit, sondern auch Diskussionen ausgelöst.
Kapitelübersicht
1 Was ist Biologische Landwirtschaft?
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 2.1 Verordnung (EWG) 2092/91
- 2.2 Lebensmittel Codex A.8.
- 2.3 Privatrechtliche Regelungen für Biolandbau
- 2.4 Kontrolle und Zertifizierung
- 3.1 Rudolf Steiner
- 3.2 Hans und Maria Müller und Dr. Rusch
- 3.3 Gerhard Plakolm und Alfred Haiger
- 3.4 Karl Wlaschek und Werner Lampert
- 4.1 Produkte tierischer Herkunft
- 4.2 Produkte pflanzlicher Herkunft
- 4.3 Convenience-Produkte
- 4.4 Non-Food-Produkte
- 5.1 Entwicklung der Vermarktung
- 5.2 Supermärkte
- 5.3 Naturkostläden
- 5.4 Direktvermarktung
- 5.5 Internet Shopping
- 5.6 Hauszustellung
- 5.7 Selbsternte
- 6.1 Entwicklung
- 6.2 Ansprüche der Großküchen
- 6.3 Lieferanten für Großküchen
- 6.4 Bio-Hotels
- 6.5 Biorestaurants
- 6.6 Gemeinschaftsverpflegung
8 Aufbereiter (Verarbeiter)
9 Bioverbände
10 Konsumenteninformation
11 Aktuelle Entwicklungen
- 11.1 Sortenraritäten
- 11.2 Fair Trade und Biolandbau
- 11.3 Bioregionen
- 11.4 Politik und Meinungsbildung
- 12.1 Regional versus Global im Biolandbau
- 12.2 Externe Effekte der Landwirtschaft
- 12.3 Wertewandel
- 12.4 Unternehmertum - Verunternehmerisierung
- 12.5 Wettbewerb - Preise
1 Was ist Biologische Landwirtschaft?
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Der Begriff "Biologische Landwirtschaft" (Synonym: ökologische Landwirtschaft) bezeichnet eine umwelt- und sozialverträgliche Wirtschafts- und Bodennutzungsform innerhalb der Landwirtschaft. Sie ist durch rechtliche Rahmenbedingungen[1] (staatliche und privatrechtliche Regelungen) geregelt. Diese Regelungen schreiben auch die eindeutige Kennzeichnung von Bioprodukten vor. Produkte, die mit diesem Begriff werben, müssen nach den Produktionsrichtlinien des Biologischen Landbaus hergestellt worden sein.
Eines der wichtigsten Charakteristika der Biologischen Landwirtschaft ist die ganzheitliche Betrachtung des landwirtschaftlichen Betriebes. Natürliche Lebensprozesse sollen gefördert und Stoffkreisläufe weitgehend geschlossen werden. In der Praxis bedeutet das:
- Verbot der Anwendung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel und leicht löslicher Mineraldünger;
- Förderung der Gesundheit und Fruchtbarkeit des Bodens durch schonende Bodenbearbeitung, natürliche Düngemittel und eine ausgewogene Fruchtfolge;
- Förderung der natürlichen Selbstregulationsmechanismen eines intakten Ökosystems;
- Verbot des Einsatzes von Gentechnik in allen Bereichen des Bio-Landbaus;
- Artgerechte Tierhaltung, Fütterung mit biologisch produziertem Futter.
Quellen: Herrman und Plakolm 1991, www.bioinformation.at[2]
Klare gesetzliche Regelungen und Kontrollen[3] garantieren, dass Bio-Produkte nach den Richtlinien des Biologischen Landbaus produziert wurden. Bezeichnungen wie "aus kontrolliertem Anbau" oder "aus naturnahem Anbau" haben mit Biolandbau nichts zu tun. Bioprodukte dürfen die folgenden Bezeichnungen tragen:
- "aus (kontrolliert) biologischem (ökologischem) Anbau (Landbau)"
- "aus (kontrolliert) biologischer (ökologischer) Landwirtschaft".
Produkte, die nicht vollständig den gesetzlichen Regelungen für den Biolandbau entsprechen, dürfen diese Hinweise auf "öko" oder "bio" nicht tragen und auch nicht in Bezug zu diesen ausgelobt werden.
Neben dieser Bezeichnung tragen Bioprodukte den Vermerk der verantwortlichen Kontrollstelle. Die Kontrollstelle kann entweder namentlich genannt und/oder durch die Kontrollnummer (z.B.: AT - N - 01 - BIO) bezeichnet sein.
Das "EU-Bio-Zeichen" gemäß Verordnung (EWG) 2092/91 garantiert Bio-Qualität von Lebensmitteln, die nach den Richtlinien der EU-Bio-Verordnung 2092/91 hergestellt und kontrolliert werden. Es kann, muß aber nicht auf Bioprodukten angebracht sein, d.h. seine Verwendung ist freiwillig.
Neben diesen gesetzlich definierten Kennzeichnungen kann ein Bioprodukt außerdem noch zusätzlich Gütezeichen und/oder Markenzeichen tragen:
Beide AMA-Bio-Zeichen garantieren die Einhaltung der EU-Bio-Verordnung 2092/91 am gesamten Betrieb sowie darüber hinaus die Einhaltung der Bestimmungen zum Biologischen Landbau, die im Österreichischen Lebensmittelcodex Kapitel A.8 definiert sind. Das rote AMA-Zeichen macht deutlich, dass das Bioprodukt überwiegend aus österreichischen Rohstoffen hergestellt wurde. Dies bezieht sich auf die wertgebenden Inhaltsstoffe: bei Bananenmilch z.B. muß die Bio-Milch zu 100% aus Österreich stammen, die Bio-Bananen (die rund 10% des Produktes ausmachen) dürfen auch anderen Ursprungs sein. Der Begriff "Ursprung" bezieht sich auf den Rohstoffanbau sowie die Be- und Verarbeitung der Rohstoffe. Das schwarze AMA-Zeichen garantiert Bio-Produktion, aber keine bestimmtes Herkunftsland.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2
[2] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.bioinformation.at
[3] Siehe Kapitel 2
Vorheriges Kapitel: 1 Was ist Biologische Landwirtschaft?
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Kein Bereich der Landwirtschaft in Österreich weist eine derartige Regelungs- und Kontrollintensität auf wie der biologische Landbau: Die biologische Landwirtschaft ist innerhalb der EU durch die Verordnung (EWG) 2092/91, das Kapitel A.8 des Österreichischen Lebensmittelkodex und privatrechtliche Regelungen geregelt.
Die Mindestanforderungen der staatlichen Regelungen (VO 2092/91 und Codex) gelten für jeden Biobetrieb, auch wenn daneben noch privatrechtliche Vereinbarungen abgeschlossen wurden. In diesen Regelungen sind auch genaue Vorgaben für Kontrolle und Zertifizierung gemacht. Bei Verstößen gegen die staatlichen Regelungen werden strenge Sanktionen erteilt, die bis zum Ausschluß des Betriebes aus der Biovermarktung gehen können. Bei Verstößen gegen die zusätzlichen, freiwillig strengeren, privatrechtlichen Elemente hat ein Betrieb mit den privatrechtlich vereinbarten Sanktionen zu rechnen, verliert jedoch nicht seinen Status als Biobetrieb gemäß EU- Verordnung und Lebensmittelcodex.
Selbstverständlich müssen Betriebe, die nach den Richtlinien der biologischen Landwirtschaft arbeiten, alle Regelungen einhalten, die Lebensmittel, deren Erzeugung, Aufbereitung und Vermarktung betreffen, wie z.B.:
- Tierschutzgesetze
- Hygieneverordnungen
- Grundwasserschutz-Verordnungen
- etc.
Inhaltsverzeichnis
Weitere Kapitel dieser Lernunterlage
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Gründerväter
4 Produktpalette
5 Vermarktungsformen
6 Gastronomie und Grossküchen
7 Erzeuger
8 Aufbereiter (Verarbeiter)
9 Bioverbände
10 Konsumenteninformation
11 Aktuelle Entwicklungen
12 Diskussionsfelder
13 Glossar
14 Quellen
Nächstes Kapitel: 2.1 Verordnung (EWG) 2092/91
Vorheriges Kapitel: 2 Rechtliche Rahmenbedingungen
2.1 Verordnung (EWG) 2092/91
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Seit dem Beitritt Österreichs zum EWR am 1.7.1994 gilt die EU-Verordnung 2092/91 "über den biologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel" (kurz: EU-VO 2092/91) als rechtliche Grundlage und Mindestanforderung für die biologische Landwirtschaft.
Sie regelt die Tätigkeit all jener Akteure, die Produkte aus biologischer Landwirtschaft erzeugen, aufbereiten, transportieren, lagern, handeln und importieren bzw. diese Produkte und Produktionsschritte kontrollieren. Die EU-VO 2092/91 ist seit ihrer ersten Veröffentlichung in zahlreichen Folgeverordnungen abgeändert und weiterentwickelt worden. Jede dieser ergänzenden Verordnungen ist unmittelbar nach Veröffentlichung im Amtsblatt der EU österreichisches Recht und bedarf keiner nationalstaatlichen Spezifikation oder Umsetzung.
Nächstes Kapitel: 2.2 Lebensmittel Codex A.8.
Vorheriges Kapitel: 2.1 Verordnung (EWG) 2092/91
2.2 Lebensmittel Codex A.8.
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna HartlDer Codex Alimentarius Austriacus (Österreichischer Lebensmittelcodex), Kapitel A.8, "Landwirtschaftliche Produkte aus biologischem Landbau und daraus hergestellte Folgeprodukte" galt seit 1983 als staatliche Regelung für die biologische Landwirtschaft in Österreich. Damit besaß Österreich als erstes Land der Welt Richtlinien für die biologische Landwirtschaft. Bis 1994 stellte diese Regelung die gesetzliche Mindestanforderung an Produkte aus biologischer Landwirtschaft dar.
Seit dem Beitritt Österreichs zum EWR am 1.7.1994 gilt die EU-Verordnung 2092/91 als rechtliche Grundlage und Mindestanforderung für die biologische Landwirtschaft. In den vergangenen Jahren hat die Erweiterung der geregelten Bereiche in der EU-VO dazu geführt, dass heute im Lebensmittelcodex nur mehr jene Bereiche zu regeln sind, die nationalstaatliche Spezifikationen oder in der VO 2092/91 bislang nicht geregelte Bereiche darstellen. Beispiele dafür sind die biologische Teichwirtschaft oder die Gatterhaltung von Wild.
Der Lebensmittelcodex hat weder Gesetz- noch Verordnungskraft. Er hat die rechtliche Bedeutung eines "objektivierten Sachverständigengutachtens". Die Bearbeitung des Lebensmittelkodex erfolgt durch die Codexkommission, die den zuständigen Bundesministers in Angelegenheiten des Lebensmittelgesetzes sowie in der Vorbereitung der Veröffentlichung des Codex berät. Die Kommission legt Vorschläge für einzelne Codexkapitel vor, die vom zuständigen Bundesministerium in Form von Erlässen veröffentlicht werden. Das Bundesministerium ist dabei nicht an die Vorschläge der Codexkommission gebunden, folgt in der Praxis jedoch den Arbeitsergebnissen der Codexkommission (vgl. Wirtschaftskammer 2004).
Nächstes Kapitel: 2.3 Privatrechtliche Regelungen für Biolandbau
Vorheriges Kapitel: 2.2 Lebensmittel Codex A.8.
2.3 Privatrechtliche Regelungen für Biolandbau
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
In Ergänzung zu den staatlichen Richtlinien (EU-Verordnung 2092/91 und Kapitel A.8 des österreichischen Lebensmittelcodex) sind privatrechtliche Regelungen in der biologischen Landwirtschaft vorhanden. Diese stellen zusätzliche, freiwillig strengere Elemente dar. Bei Verstößen gegen diese privatrechtlichen Regelungen hat ein Betrieb mit den privatrechtlich vereinbarten Sanktionen zu rechnen, verliert aber nicht seinen Status als Biobetrieb gemäß EU- Verordnung und österreichischen Lebensmittelcodex. Solche privatrechtlichen Regelungen können sein:
- Richtlinien einiger Bioverbände[1] für ihre Mitglieder (z.B.: Bio Ernte Austria, demeter, Freiland Verband)
- Richtlinien der Inhaber von Markenzeichen (wie "Ja!Natürlich" oder "Natur Pur") für ihre Lieferanten und Lizenznehmer
- Vertragsbedingungen der AMA (Agrarmarkt Austria) für die Förderungsmaßnahme "Biologische Wirtschaftsweise" im Rahmen des ÖPUL (Österreichisches Umweltprogramm für die Landwirtschaft)
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 9
Nächstes Kapitel: 2.4 Kontrolle und Zertifizierung
Vorheriges Kapitel: 2.3 Privatrechtliche Regelungen für Biolandbau
2.4 Kontrolle und Zertifizierung
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Die Kontrolle und Zertifizierung von Biobetrieben ist in der Verordnung (EWG) 2092/91[1] streng und umfassend geregelt. Sieben private, akkreditierte Produktzertifizierungsstellen (umgangssprachlich als "Kontrollstellen" bezeichnet) begutachten zumindest einmal jährlich vollständig alle Biobetriebe (inkl. der nachgelagerten Sektoren). Diese Begutachtung vor Ort wird als "Kontrolle" oder "Inspektion" bezeichnet.
Im Rahmen eines "Vier-Augen-Prinzips" werden die Berichte dieser Kontrolle in der Kontrollstelle von dazu speziell authorisiertem Personal überprüft und erst nach vollständiger Konformität der Betriebe mit den entsprechenden Gesetzen so genannte "Zertifikate" ausgestellt. Das Personal der Kontrollstelle darf nicht in die Beratung von Biobetrieben oder in die Vermarktung von Betriebsmitteln für Biobetriebe involviert sein.
In ihrer Tätigkeit werden die Kontrollstellen von den zuständigen Organen der Lebensmittelaufsicht jedes Bundeslandes (unter Koordination des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen, BMGF) und von der Akkreditierungsstelle des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) überprüft. Diese beiden Behörden führen regelmäßig Kontrollen (so genannte Audits) in den Büros der Kontrollstellen durch und überprüfen auch die Kontrollore bei ihrer Tätigkeit auf Biobetrieben.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2.1
Inhalt
2.4.1 Kontrollstellen
In Österreich sind folgende Kontrollstellen von der Lebensmittelbehörde zugelassen und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit auf ihre Kompetenz überprüft (= gemäß Europäischer Norm 45011 akkreditiert):
- Verband Kontrollservice Tirol (BIKO Tirol)
- Salzburger Landwirtschaftliche Kontrolle (SLK)
- LACON
- Biokontrollservice Österreich (BIOS)
- Lebensmittelversuchsanstalt (LVA)
- SGS Austria Controll-Co
- Austria Bio Garantie (ABG)
Darüber hinaus werden die Namen und Adressen aller europäischen, zugelassenen Kontrollstellen regelmäßig im Amtsblatt der europäischen Union veröffentlicht. Da diese Liste und ihre Aktualität von hoher rechtlicher Bedeutung ist, wird kein Link auf die aktuelle Liste gesetzt. Die Leser werden Gebeten diese bei z.B. den Kontrollstellen zu erheben, sofern hierfür Interesse besteht.
2.4.2 BMWA: Akkreditierung der Kontrollstellen
Mit 1.1.1998 fordert die VO 2092/91, dass die Bio-Kontrollstellen die Bedingungen der Norm EN 45011 erfüllen müssen. In Österreich wird diese Vorgabe, anders als z.B. in Deutschland, so interpretiert, dass die Bio-Kontrollstellen entsprechend dem österreichischen Akkreditierungsgesetz (AkkG) per Verordnung des BMWA (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit) zu akkreditieren sind. Für diese Akkreditierung ist die Akkreditierungsstelle ' des ' BMWA, die zweite Säule der Regelung des Biologischen Landbaus, zuständig.
Die Akkreditierungsstelle des BMWA führt in der Kontrollstelle eine Prüfung des Qualitäts- Managementsystems (QM) auf Konformität mit der EN 45011 durch. Diese Prüfung beinhaltet die systematische und vollständige Begutachtung und Bewertung des QM-Handbuchs, aller Abläufe und Tätigkeiten in den Geschäftsstellen der Kontrollstelle sowie die Umsetzung der QM- Vorgaben bei Kontrollen vor Ort. Nach der Akkreditierung erfolgt jährlich eine Überwachung. Für dieses Verfahren sind spezifisch für diese Tätigkeit ausgebildete Auditoren und Sachverständige eingesetzt. Die Akkreditierungsstelle des BMWA wird in ihrer Tätigkeit durch die EA (European Association for Accreditation) überwacht.
2.4.3 BMGF: Zulassung und Überwachung der Kontrollstellen
Das BMGF (Bundesministerium für Gesundheit und Frauen) ist für die Umsetzung der VO 2092/91 sowie für die Zulassung und Überwachung der privaten Kontrollstellen zuständig. Das BMGF ist auch nationaler Ansprechpartner für die Europäische Union (Ständiger Ausschuss und Art.-14-Arbeitsgruppe). Das BMGF ist damit die zentrale Säule der Regelung des Biologischen Landbaus in Österreich. Das BMGF hat Teile dieser Zuständigkeit mit der Novelle zum Lebensmittelgesetz vom 30.4.1998 teilweise an die Bundsländer übertragen. In Österreich sind derzeit sieben Kontrollstellen zugelassen und akkreditiert.
Vorheriges Kapitel: 2.4 Kontrolle und Zertifizierung
3 Gründerväter
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Der Biolandbau in Östereich ist vom Wirken vieler Menschen geprägt. Beispielhaft seien folgende Personen und ihre Arbeit näher besprochen:
- Rudolf Steiner hat 1924 die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise begründet.
- Hans und Maria Müller und Hans Peter Rusch haben nach dem zweiten Weltkrieg die organisch-biologische Wirtschaftsweise ins Leben gerufen.
- Gerhard Plakolm und Alfred Haiger haben entscheidend die Institutionalisierung von Forschung und Lehre zum Biolandbau an der Universität für Bodenkultur in Wien bestimmt.
- Karl Wlaschek und Werner Lampert haben mit der Vermarktung von Bioprodukten in österreichischen Supermärkten begonnen und damit eine Wende im Marktauftritt des Biolandbaus eingeleitet.
Inhaltsverzeichnis
Weitere Kapitel dieser Lernunterlage
1 Was ist Biologische Landwirtschaft?
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
4 Produktpalette
5 Vermarktungsformen
6 Gastronomie und Grossküchen
7 Erzeuger
8 Aufbereiter (Verarbeiter)
9 Bioverbände
10 Konsumenteninformation
11 Aktuelle Entwicklungen
12 Diskussionsfelder
13 Glossar
14 Quellen
Nächstes Kapitel: 3.1 Rudolf Steiner
Vorheriges Kapitel: 3 Gründerväter
3.1 Rudolf Steiner
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna HartlDr. Rudolf Steiner wurde am 27.2.1861 in Kraljevec im damaligen Österreich (heute Ungarn) geboren. Er studiert an der Wiener Technischen Hochschule Mathematik und Naturwissenschaften, daneben Literatur, Philosophie und Geschichte. Er arbeitet an verschiedenen Herausgaben von Goethes Werken mit, arbeitet als Privatlehrer und später in Weimar im Goethe- Schiller-Archiv. 1891 promoviert er zum Doktor der Philosophie. In dieser Zeit entstehen mehrere philosophische und philosophiegeschichtliche Schriften, unter ihnen auch die "Philosophie der Freiheit" von 1894, das meist als sein Hauptwerk angesehen wird. Rudolf Steiner wendet sich in seiner schriftstellerischen Tätigkeit sowohl der östlichen Esoterik der Theosophie als auch dem Christentum zu und erarbeitet in seiner so genannten Anthroposophie eine esoterische, auf Erkenntnis gegründete Christologie.
Im Jahr 1924 entwickelt Steiner eine umfangreiche Vortragstätigkeit, unter anderem auch über die "Geisteswissenschaftlichen Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft". Mit diesen Vorträgen rief er die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise ins Leben. Im September 1924 muss Rudolf Steiner seine Vortragstätigkeit aus Gesundheitsgründen einstellen. Er stirbt am 30.3.1925 in Dornach.
Quelle: www.rudolf-steiner.de[1]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.rudolf-steiner.de
Inhalt
3.1.1 Biologisch-Dynamische Landwirtschaft
Dr. Rudolf Steiner gilt als Begründer der Anthroposophie. Im Jahr 1924 hat er durch acht Vorträge über die "Geisteswissenschaftlichen Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft" die biologisch- dynamische Wirtschaftsweise ins Leben gerufen. Diese Form der biologischen Landwirtschaft wird als einziger Bioverband weltweit mit einheitlichen Richtlinien durch den Demeter-Bund vertreten.
Die biologisch-dynamische Landwirtschaft baut auf eine geisteswissenschaftliche Sichtweise auf. Der landwirtschaftliche Betrieb wird als Organismus gesehen. Auch die Kräfte des Kosmos (Mond und Gestirne) werden in die Arbeit einbezogen. Ein wesentlicher Unterschied zur organisch- biologischen Wirtschaftsweise ist die Anwendung spezieller Präparate, die aus Organen von Tieren (meist der Kuh), Kräutern, Mist und Quarzmehl hergestellt und in homöopathischen Dosen angewendet werden. Sie werden dem Mist beigegeben oder auf den Feldern ausgebracht und wirken positiv auf das Pflanzenwachstum. Diese positive Wirkung der Präparate kann naturwissenschaftlich nachgewiesen werden, der Wirkmechanismus jedoch nicht.
Quelle: www.rudolf-steiner.de[1]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.rudolf-steiner.de
3.1.2 Anthroposophie
Das Denken als beobachtbarer Akt der Wirklichkeit ist der philosophische Ansatz, den Rudolph Steiner unter dem Namen Anthroposophie zu einer Lehre von der sogenannten Wahrnehmung höherer Welten ausbaut. Die Umwendung des Denkens auf den Denkprozess selbst führt nach Steiner zu einer Erweiterung der Wahrnehmungsfähigkeit in eine geistige Dimension, in der die begrifflichen Zusammenhänge nicht nur deduktiv und spekulativ als Gedanken-Resultate erörtert, sondern als geistige Anschauung eine empirische Forschung der seelischen und geistigen Wirklichkeit des Menschen und der Welt ermöglichen.
Steiner hinterläßt mit seinen vielen stenographisch aufgezeichneten Vorträgen ein umfangreiches schriftliches Werk sowie eine gesellschaftliche Strömung, deren Wirkungen auch außerhalb anthroposophischer Institutionen ihre Spuren hinterlassen hat. Nur wenige Theoretiker blicken auf eine so umfangreiche praktische Anwendung ihrer Ideen. Dennoch wird er im akademischen Kanon weitestgehend ignoriert und nur in den Erziehungswissenschaften und neuerdings der Medizin bisweilen ernsthaft diskutiert.
Quelle: www.rudolf-steiner.de[1]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.rudolf-steiner.de
Nächstes Kapitel: 3.2 Hans und Maria Müller und Dr. Rusch
Vorheriges Kapitel: 3.1 Rudolf Steiner
3.2 Hans und Maria Müller und Dr. Rusch
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna HartlNach dem zweiten Weltkrieg wurde die organisch-biologische Wirtschaftsweise vom Schweizer Hans Müller und seiner Frau Maria, sowie dem Preußen Dr. Hans Peter Rusch begründet. Damit sollte gegen die Abhängigkeit der Betriebe von zugekauften Betriebsmitteln angekämpft werden. Diese Wirtschaftsweise in der biologischen Landwirtschaft wird weltweit am häufigsten praktiziert. Sie betrachtet die Landwirtschaft aus naturwissenschaftlicher Sicht.
Ein Beispiel für einen traditionsreichen Bioverband, der diese Wirtschaftsweise aufgriff ist die "Förderungsgemeinschaft für Gesundes Bauerntum", kurz auch ORBI genannt. ORBI bezeichnet sich als die Pioniergruppe des organisch-biologischen Landbaues in Österreich. 1959 wurde sie gegründet und trug 20 Jahre lang allein den organisch- biologischen Landbau in Osterreich.
1962 reiste diese Gruppe zum ersten Mal in die Schweiz zu Dr. Müller. Nach der Rückkehr stellten drei Gründungsmitglieder der Förderungsgemeinschaft ihre Betriebe auf die organisch-biologische Landbaumethode um. 1962 sprach Dr. Müller bereits auf der Jahreshauptversammlung der Förderungsgemeinschaft, und 1963 folgte eine Vortragsreise von Doz. Dr. Rusch durch Österreich. Es folgten Lehrfahrten durch die Schweiz und die Gründung von Bauerngruppen, die ihre Betriebe umstellten. Dr. Müller besuchte die Bauerngruppen jährlich und ebenso jährlich hielt er eine lnformationstagung in Salzburg. Der Kontakt mit ihm blieb aufrecht bis zu seinem Tod. Das oberste Ziel der Förderungsgemeinschaft ist es, die Methoden der organisch-biologischen Landwirtschaft nach Dr. Müller unverfälscht weiter zu geben.
Quelle: www.orbi-bauernladen.at[1]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.orbi-bauernladen.at
Nächstes Kapitel: 3.3 Gerhard Plakolm und Alfred Haiger
Vorheriges Kapitel: 3.2 Hans und Maria Müller und Dr. Rusch
3.3 Gerhard Plakolm und Alfred Haiger
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Gerhard Plakolm und Alfred Haiger gelten als Gründerväter des Biologischen Landbaus an der Universität für Bodenkultur in Wien. Bereits im Jahr 1976 hat Gerhard Plakolm das erste Seminar zum Biologischen Landbau an einer europäischen Universität, an der BOKU in Wien, organisiert. In der Folge hat er an der BOKU gegen den Widerstand der Vertreter der konventionellen Landwirtschaft, und zu Beginn nur mit der Unterstützung des Professors für Tierzucht, Alfred Haiger, eine Vorlesungsreihe zum Ökologischen Landbau aufgebaut. Aus diesem Freifach wurde durch engagierten Einsatz alternativ denkender, innovativer Studenten 1986 ein zweistündiges Wahlfach im Studienzweig Pflanzenproduktion. Thomas Lindenthal konnte später auf diesen Vorarbeiten aufbauen. Ihm ist wesentlich zu verdanken, dass im Jahr 1992 eine Gastprofessur für Ökologischen Landbau (Prof. Jürgen Heß) und im Jahr 1996 das Institut für Ökologischen Landbau[1] eingerichtet wurden. Erst 25 Jahre nach den ersten Schritten wird im Jahr 2000 Ökologischer Landbau Pflichtfach im Studium der Landwirtschaft.
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.nas.boku.ac.at/oekoland.html
Nächstes Kapitel: 3.4 Karl Wlaschek und Werner Lampert
Vorheriges Kapitel: 3.3 Gerhard Plakolm und Alfred Haiger
3.4 Karl Wlaschek und Werner Lampert
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Der Einstieg der Supermarktkette Billa/Merkur in die Vermarktung von Produkten aus Ökologischem Landbau im Jahr 1994 gilt als eine Wende im Marktauftritt des Biolandbaus. War dieser bis dahin durch Vermarktung ab Hof, Bauernmärkte, Bauernläden und den Naturkosthandel geprägt, so führen ab diesem Jahr "plötzlich" alle Filialen dieser Kette Bioprodukte (Marke "Ja!natürlich"), wobei das Sortiment kontinuierlich ausgeweitet wird und bald auch Produkte wie Bio-Pizza, Bio-Speiseeis oder Bio-Tiefkühlprodukte umfaßt. Als Motoren hinter dieser Entwicklung gelten der Besitzer dieser Supermarktkette, Karl Wlaschek, und der für Marketing und Produktentwicklung zuständige Werner Lampert. Später folgten andere Supermarktketten diesem Beispiel (z.B. Spar, M-Preis und Hofer).
Vorheriges Kapitel: 3.4 Karl Wlaschek und Werner Lampert
4 Produktpalette
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Das Angebot an Bioprodukten umfasst heute praktisch alle Arten von Lebensmitteln, pflanzliche unverarbeiteten Erzeugnissen wie Getreide, Obst oder Gemüse, tierische Erzeugnisse, bis hin zu hoch verarbeiteten Convenience-Produkten wie Germknödel, Tiefkühl-Pommes frites oder Pizza. Nicht nur Lebensmittel werden in biologischer Qualität produziert, auch Textilien oder Kosmetikartikel aus biologischen Rohstoffen finden sich im Angebot. Sogar Hunde- und Katzennahrung aus Bio-Rohstoffen gibt es bereits.
Die BioFach[1], eine jährlich in Deutschland stattfindende internationale Fachmesse für Naturkost und Naturwaren, bietet einen sehr guten Einblick über Angebot, Innovationen und Trends am Biomarkt. Bis vor zehn Jahren wurden biologische Waren in spezialisierten Geschäften wie Naturkost- und Reformläden oder direkt beim Bauern ab Hof sowie auf einigen Bauernmärkten verkauft. Im Jahr 1994 stiegen auch die einzelnen Lebensmittelketten in die Vermarktung biologischer Produkte ein. Die Präsenz der biologischen Landwirtschaft in den Medien verstärkte sich in dieser Zeit durch Werbung der Bioverbände und der Handelsketten. Seither ist der Absatz von Bioprodukten stark angestiegen. In Österreich kam es nach einem Boom in der Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln Mitte der 90-er Jahre zu einem moderaten Wachstum.
In der Entwicklung der Produktpalette zeigt sich auch einen Imagewandel von Bioprodukten: Wurde "Bio" früher mit einer bestimmten Ernährungsideologie, besonders mit Vollwert- und vegetarischer Ernährung in Verbindung gebracht, so steht heute der Genuss und der Wunsch nach "wohltuenden", gesunden Lebensmitteln im Vordergrund. Die Einführung von Bio-Convenience- Produkten trägt außerdem den geänderten Lebensbedingungen Rechnung, in denen der Faktor Zeit immer wichtiger und knapper wird.
Quellen: mündliche Auskunft im November 2004 von Hr. Hardegg (ARGE Hochlandrind), Helmut Weiß (Bio Ernte Steiermark, Gemüsespezialist), Karl Waltl (Bio Ernte Steiermark, Obstspezialist), Sonja Wlcek (Bio Ernte Austria, Qualitätsmanagement Bioschweine), Ewald Stögermeier (Erzeugergemeinschaft Bioschwein).
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.biofach.de
Inhaltsverzeichnis
- 4.1 Produkte tierischer Herkunft
- 4.2 Produkte pflanzlicher Herkunft
- 4.3 Convenience-Produkte
- 4.4 Non-Food-Produkte
Weitere Kapitel dieser Lernunterlage
1 Was ist Biologische Landwirtschaft?
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Gründerväter
5 Vermarktungsformen
6 Gastronomie und Grossküchen
7 Erzeuger
8 Aufbereiter (Verarbeiter)
9 Bioverbände
10 Konsumenteninformation
11 Aktuelle Entwicklungen
12 Diskussionsfelder
13 Glossar
14 Quellen
Nächstes Kapitel: 4.1 Produkte tierischer Herkunft
Vorheriges Kapitel: 4 Produktpalette
4.1 Produkte tierischer Herkunft
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Das Bio-Angebot von Produkten tierischer Herkunft umfasst Fleisch und weiterverarbeitete Produkte (z.B. Wurst) vom Rind, Schwein, Lamm, Ziege, Geflügel sowie Fisch. Weitere Produkte sind Eier, Milch & Milchprodukte und Honig. Rindfleisch, Schweinefleisch, Huhn und Eier, sowie Milch und Milchprodukte sind auch im Bio-Sortiment von Supermärkten vertreten. Richtlinien für Tiere und tierische Erzeugnisse sind in der EU-Verordnung 2092/91, im Österreichischen Lebensmittelcodex und in den Verbandsrichtlinien enthalten.
Inhalt
4.1.1 Richtlinien für Tiere und tierische Erzeugnisse
In der biologischen Landwirtschaft gibt es auch Richtlinien für Tiere und tierische Erzeugnisse. Die EU-Verordnung 2092/91[1] enthält seit 1999 Richtlinien für die tierische Produktion auf Biobetrieben. Es sind jedoch nicht alle Nutztierarten darin geregelt: Richtlinien finden sich für Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Equiden (Pferdeartige) und Geflügel (EU-VO 2092/91, Anhang I, B).
Neben der EU-VO gilt auch der Österreichische Lebensmittelkodex[2], Kapitel A.8, Teilkapitel B. Im Kodex sind manche Tierhaltungsbereiche geregelt, die in der EU-VO nicht behandelt werden. Als Beispiel ist hier die Bio-Fischhaltung und die Haltung von Wild in Gattern (Dammwild) zu nennen. Ist der Bio-Betrieb außerdem Mitglied in einem Bioverband[3], so sind zusätzlich zu diesen gesetzlichen Mindeststandards die Richtlinien des Verbandes einzuhalten. Diese können über die Standards von EU-VO und Lebensmittelkodex hinausgehende Tierhaltungsrichtlinien enthalten. Ein Beispiel: Der Freiland-Verband hat sich ganz auf die tiergerechte Nutztierhaltung spezialisiert. Seine Tierhaltungsrichtlinien gelten als die strengsten in Österreich.
Wichtige Merkmale der Bio-Tierhaltung sind:
Die Tierhaltung muss flächengebunden erfolgen. Das bedeutet, dass nur so viele Tiere gehalten werden dürfen, wie landwirtschaftliche Nutzflächen (LN) zur Verfügung stehen. In der EU-VO finden sich die höchstzulässigen Tierzahlen je Hektar. Beispielsweise dürfen nur 2 Milchkühe oder 14 Mastschweine pro Hektar LN auf dem Betrieb gehalten werden. Auf einem Betrieb mit 15 Hektar Nutzfläche dürfen also maximal 30 Milchkühe gehalten werden.
Der Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung (z.B. Mist oder Gülle) stellt eine erneuerbare natürliche Nährstoffquelle dar. Durch die Kombination von Pflanzenbau und Tierhaltung wird eine langfristige Erhaltung und Verbesserung der Böden sowie die Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft gefördert.
Die artgerechte Haltung der Tiere muss gewährleistet sein. Den Tieren müssen gesetzlich vorgeschriebene Mindeststallflächen zur Verfügung stehen. Sie müssen außerdem Auslauf haben.
Es sind Rassen zu wählen, die die Fähigkeit zur Anpassung an die Umweltbedingungen haben. Einheimischen Rassen und Linien ist der Vorzug zu geben. Außerdem sind Vitalität und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten wichtige Parameter bei der Wahl der Rassen.
Die Fütterung hat mit biologischem Futter zu erfolgen. Ein Anteil von 30% Futter aus Umstellung (d.h. von einem Betrieb, der zwar schon biologisch wirtschaftet, jedoch noch die vorgeschriebene Umstellungszeit zu durchlaufen hat) ist zulässig. Stammt das Umstellungsfutter vom eigenen Betrieb, so ist ein Anteil von 60% erlaubt. Ist eine Versorgung der Tiere nicht gänzlich mit Bio-Futter möglich (z.B. weil es noch nicht in ausreichendem Ausmaß produziert wird), so sind Anteile von maximal 10% (für Pflanzenfresser) bzw. 20% (für alle übrigen Tierarten) an konventionell produziertem Futter zulässig. Der Landwirt hat bei der Kontrollstelle glaubhaft nachzuweisen, dass diese Notwendigkeit besteht. Diese Regelung für konventionelle Futteranteile gilt jedoch nur mehr bis August 2005.
Die Krankheitsvorsorge besteht im wesentlichen in der Wahl geeigneter Rassen und einer artgerechten Haltung. Außerdem wird hochwertiges Futter, dass den physiologischen Bedürfnissen der Tiere entspricht, eingesetzt. Die Tiere haben ausreichend Platz, was zusätzlich Krankheitsdruck und Stress verringert. Dadurch lassen sich viele Krankheiten verhindern. Ist eine Behandlung notwendig, so ist alternativen Heilmethoden wie Phytotherapie oder Homöopathie der Vorzug zu geben. Ist die Behandlung mit chemisch-synthetischen, allopathischen Mitteln aufgrund einer tierärztlichen Diagnose notwendig, so sind die gesetzlichen Wartezeiten (Zeit zwischen Anwendung des Mittels und einer Nutzung der Erzeugnisse dieses Tieres wie Fleisch oder Milch) zu verdoppeln.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2.1
[2] Siehe Kapitel 2.2
[3] Siehe Kapitel 9
4.1.2 Rindfleisch
Das Rind eignet sich besonders gut für die Haltung auf Bio-Betrieben. Als Wiederkäuer kann es Gras in seinem Organismus aufschließen und nutzen. Daher steht es nicht mit dem Menschen in Konkurrenz um Nahrungsmittel. Außerdem ist in Österreich viel Weideland (Almen!) verfügbar, sodass die Versorgung der Rinder mit artgerechtem Futter (Gras, Heu, Silage) relativ einfach möglich ist. Der Wirtschaftsdünger aus der Rinderhaltung stellt eine wertvolle Nährstoffquelle für den Bio-Betrieb dar.
Aus diesen Gründen werden auf 75% der Biobetriebe Rinder gehalten (BMLFUW 2004: /www.gruener-bericht.at[1]). Durch das große Angebot an Bio-Rindfleisch gestaltet sich der Absatz schwierig. Um neue Vermarktungswege zu erschließen, wurden Markenprogramme ins Leben gerufen.
Eine wichtige Haltungsform der Bio-Rinderhaltung ist die Mutterkuhhaltung. Diese Haltungsform entspricht weitgehend den natürlichen Bedürfnissen der Rinder. In der Vermarktung von Rindfleisch werden verschiedene Kategorien unterschieden. Diese beziehen sich auf das Alter (z.B. Kalb, Jungrind) oder das Geschlecht (z.B. Kalbin, Mastochse) der Tiere.
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.gruener-bericht.at
4.1.2.1 Absatz und Vermarktung
Bio-Rindfleisch hat einen bedeutenden Anteil an der Vermarktung von Bioprodukten. Im Jahr 2002 wurden auf etwa 75% der Bio-Betriebe Rinder gehalten (Berechnung nach BMLFUW 2004: /www.gruener-bericht.at[1]). Aufgrund des großen Angebotes an Bio-Rindfleisch werden jedoch nur etwa 10% auch als biologisch vermarktet (BMLFUW 2003: Lebensmittelbericht Österreich). Die Vermarktungslage kann also als angespannt bezeichnet werden. Der größte Teil des Bio- Rindfleisches wird zu konventionellen Preisen verkauft. Und das, obwohl die Bio-Betriebe von denen es stammt, die strengen Bio-Richtlinien einhalten.
Bio-Rindfleisch wird zu etwa gleichen Teilen direkt (im Ab-Hof-Verkauf[2], auf Bauernmärkten[3], in Naturkostläden[4] und in der Gastronomie[5]) sowie indirekt (über Handelsketten, Industrie, Großküchen[6] und den Export) vermarktet. Ein Hoffnungsmarkt ist der EU-Binnenmarkt, da es nur wenige Mitgliedsstaaten gibt, welche ihre Nachfrage aus der eigenen Produktion decken können (BMLFUW 2003: Lebensmittelbericht Österreich).
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.gruener-bericht.at
[2] Siehe Kapitel 5.4.3
[3] Siehe Kapitel 5.4.1
[4] Siehe Kapitel 5.3
[5] Siehe Kapitel 6
[6] Siehe Kapitel 6.3
4.1.2.2 Marken
Vermarktungsinitiativen können eine Möglichkeit sein, den Absatz von Bio-Rindfleisch zu steigern. Unter Verwendung von speziellen Markennamen schließen sich Bio-Rinderhalter zusammen, um so die Bekanntheit der Marke für sich nutzen zu können. Außerdem kann durch einen solchen Zusammenschluss die Verhandlungsposition im Umgang mit Partnern aus Lebensmittelhandel und Gastronomie gestärkt werden. Beispiele dafür sind Styria Beef oder Highlandbeef.
4.1.2.2.1 Highlandbeef
Das Bio-Rindfleisch, das unter der Marke Highlandbeef vertrieben wird, stammt von Hochlandrindern aus Mutterkuhhaltung. Das Hochlandrind stammt ursprünglich aus Schottland. Seit 1985 wird es in Österreich gezüchtet. Diese Rasse gilt als sehr robust, anpassungsfähig und winterhart. Daher kann es ganzjährig im Freiland bzw. in stallloser Haltung bei minimalem Arbeitsaufwand gehalten werden. Die Tiere haben außerdem gute Muttereigenschaften, sind fruchtbar, leichtkalbend, langlebig, gesund und gutmütig, weshalb sie sich für die Mutterkuhhaltung gut eignen. Die Hochlandrinderhalter definieren ihren Betriebserfolg über die gute Fleischqualität sowie vermiedene Kosten dieser extensiven Rindermast (z.B. keine Kosten für Kraftfutter), nicht über Hochleistungen in der Mast der Tiere.
Highlandbeef ist die Marke der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Hochlandrinderzüchter. Diese ARGE ist ein Verein, der ohne öffentliche Mittel die Interessen der Mitglieder (Hochlandrinderzüchter) vertritt. Neben der Beratung, Aufklärung und Betreuung der Mitglieder in allen züchterischen, produktions- und absatztechnischen Fragen ist die Erarbeitung von Marketingkonzepten, Erschließung von Vertriebswegen, Erarbeitung von Produktionsrichtlinien und die Organisation einer Qualitätskontrolle erklärtes Ziel. Die ARGE bietet u.a. Ihren Bio-Mitgliedern die Nutzung der Marke Highlandbeef.
Quelle: www.highlandbeef.at[1]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.highlandbeef.at
4.1.2.2.2 Styria Beef
Rinder, die über das Styria Beef-Programm vermarktet werden, stammen aus biologischer Mutterkuhhaltung. Dabei saugen die Kälber bei den Kühen, bis sie im Alter von 10–12 Monaten abgesetzt werden. Die Tiere gehen in keine End- oder Ausmast, sondern werden unmittelbar nach dem Absetzen vermarktet. Die Tiere wachsen bei den Kühen auf, saugen die gesamte Milch der Mutterkuh und haben Gras, Heu oder Silage zur freien Aufnahme zur Verfügung. Wenn Getreide beigefüttert wird, stammt dieses Getreide von Biobetrieben. Styria Beef Rinder erreichen die Schlachtreife im Alter von 10–12 Monaten. In der Vermarktung werden sie daher als Jungrinder bezeichnet.
Eine Besonderheit in der Styria Beef Zucht ist der Einsatz von Zuchttieren der Rasse Limousin. Limousin ist eine französische Fleischrasse mit besonders guter Bemuskelung, einer feinen Faserung und Marmorierung. Diese spezielle Kreuzung bringt mit sich, dass die Fleischqualität besonders gut ist bezüglich Muskelausbildung, Feinfaserigkeit, Zartheit und Fleischfarbe. Styria Beef Jungrindfleisch wird entweder über den Steirischen Fleischrinderverband im Handel vermarktet, oder direkt Ab-Hof von den Betrieben.
Quelle: www.styria-beef.at[1]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.styria-beef.at
4.1.2.3 Mutterkuhhaltung
Die Mutterkuhhaltung ist eine wichtige Haltungsform in der Bio-Rindermast. Darunter versteht man die Haltung von Mutterkühen in Gruppen gemeinsam mit ihrer Nachzucht. Oft ist auch ein Stier ständig in der Gruppe, der die Kühe deckt. Die Haltung erfolgt entweder im Stall mit Auslauf oder in Weidehaltung. Die Kälber können bis zum Erreichen des Schlachtgewichtes in der Mutterkuhgruppe bleiben. Sie wachsen bei den Kühen auf, saugen die gesamte Milch der Mutterkuh und haben Gras, Heu oder Silage zur freien Aufnahme zur Verfügung. Die Mutterkuhhaltung ist eine extensive und arbeitszeitsparende Haltungsform. Darüber hinaus entspricht sie weitgehend den natürlichen Bedürfnissen der Rinder.
Da der direkte Umgang mit den Tieren bei dieser Haltungsform nicht regelmäßig notwendig ist und die Rinder vermehrt sich selbst überlassen sind, können Probleme auftreten. Die Tiere werden scheu, sodass der Umgang mit ihnen und das Einfangen (z.B. bei tierärztlichen Untersuchungen oder bei einem Transport) schwierig wird. Hier liegt es am Tierhalter, eine gute Mensch-Tier- Beziehung schon mit den Kälbern aufzubauen. So kann Stress für Tier und Mensch vermieden werden.
4.1.2.4 Fleischkategorien
In der Rinderhaltung und bei der Vermarktung von Rindfleisch unterscheidet man folgende Kategorien:
- Kalb: Rind bis zu einem Alter von 6 Monaten
- Jungrind: männliches oder weibliches Rind bis zu einem Alter von 12 Monaten
- Mastrind: männliches oder weibliches Rind mit einem Alter von mehr als 12 Monaten
- Ochse: kastriertes männliches Rind
- Weideochse: Ochse, der während des Sommers auf einer (Alm-)Weide gehalten wird
- Kalbin: junge, aber ausgewachsene Kuh, die noch kein Kalb geboren hat
Quelle: www.ama.at[1]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.ama.at
4.1.3 Schweinefleisch
Die Haltung von Bio-Schweinen ist in Österreich eher gering vertreten. Die Vermarktungslage ist angespannt. Das ist vor allem auf die geringe Nachfrage von Bio- Schweinefleisch aufgrund des höheren Preises zurückzuführen. Außerdem hat Schweinefleisch bei den ernährungsbewussten KonsumentInnen zu Unrecht ein schlechtes Image.
Die Haltung im Freiland, die in den Jahren 2001 und 2002 große Aufmerksamkeit erregte und dadurch ausgeweitet wurde, erlebte ab 2003 einen Rückgang. In der Zukunft wird man verstärkt Aufklärungsarbeit zu den Vorzügen des Bio-Schweinefleisches leisten und neue Vermarktungswege erschließen müssen. Der Qualitätsbegriff bedarf einer Überarbeitung, will man sich von konventionellem Fleisch abgrenzen können.
4.1.3.1 Entwicklung der Bio-Schweinehaltung
Die Haltung von Bioschweinen ist wenig verbreitet in Österreich. 2002 betrug der Anteil von Bioschweinen am gesamten Schweinebestand nur 0,95%, stieg jedoch 2002 und 2003 um etwa 15% auf 1,2% des Gesamtbestandes an.
Herrschte 2002 noch ein Mangel an Bio-Schweinefleisch, so gab es im Frühjahr 2004 erstmals Überproduktion, da viele Betriebe aufgrund der hohen Nachfrage 2002 auf Bio-Schweinemast umgestiegen sind. Bio-Schweinefleisch wird deshalb teilweise nicht als "Bio" in den Handelsketten vermarktet und zum konventionellen Preis verkauft.
Die meisten Bioschweine werden in mit Stroh eingestreuten Ställen mit Auslauf gehalten. Bis 2010 sind noch Übergangsregelungen wirksam, die besonders im Bereich der Ferkelaufzucht die Haltung ohne Auslauf erlauben. Die Freilandhaltung von Schweinen, die ab dem Jahr 2001 einen großen Aufschwung erlebte und auch verstärkt in den Medien präsent war, ist im Jahr 2004 stark im Abnehmen begriffen.
4.1.3.2 Vermarktung
Derzeit wird nach groben Schätzungen ein Drittel des Bio-Schweinefleisches direkt vermarktet[1]. Die anderen zwei Drittel werden über die "Erzeugergemeinschaft Bioschwein" abgesetzt, die den Lebendmittelhandel und Großküchen versorgt. In diese Schätzungen nicht einbezogen sind Bioschweine, die für die Selbstversorgung auf Biobetrieben gehalten werden.
Nachdem bis zum Jahr 2003 die Bio-Schweinehaltung in Österreich stagnierte bzw. leicht rückläufig war, kam es Ende 2003 zu einem Anstieg in diesem Sektor. Gab es 2002 noch einen Mangel an Bio-Schweinefleisch, so sprechen Experten 2004 schon von einer Überproduktion. Die Gründe dafür liegen in der Vermarktung des Fleisches, die hauptsächlich über die großen Handelsketten[2] läuft. In den Supermärkten wird das Bio-Schweinefleisch jedoch aufgrund seines um 70-100% höheren Preises wenig nachgefragt. Die Gründe für den Mehrpreis sind längere Mastzeiten, höherer Platzbedarf und teures Biofutter. Außerdem hat Schweinefleisch den Ruf, nicht so gesund zu sein, was besonders Bio-Konsumenten zu anderen Lebensmitteln greifen lässt.
Die Vermarktung über Großküchen[3] wird als schwierig bezeichnet, da der Mehrpreis dazu führt, auf billigeres Biofleisch zurückzugreifen. Beim Rindfleisch ist der Preisunterschied zwischen Bio und Konventionell geringer, da in der Rindermast die Futtermittel günstiger sind. Ein weiteres Problem in der Vermarktung ist der Qualitätsbegriff bei Schweinefleisch, der besonders mageres Fleisch verlangt. Diese Qualitätsklassen gelten auch für Biofleisch, obwohl erwiesen ist, dass ein etwas höherer Fettanteil den Geschmack positiv beeinflusst. Hier wäre eine Neudefinition des Qualitätsbegriffes für Bioschweinefleisch dringend notwendig, um sich geschmacklich von konventionellen Produkten abheben zu können.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 5.4
[2] Siehe Kapitel 5.2
[3] Siehe Kapitel 6
4.1.3.3 Freilandschweine
Eine mögliche Alternative, die Investitionskosten für Stallum- und Stallneubauten zu umgehen, ist die Freilandhaltung von Hausschweinen. Die Freilandhaltung ist eine natürliche Form der Tierhaltung. Sie wird aber nur dann den Bedürfnissen der Tiere gerecht, wenn gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Dabei muss sich ein Freiland-Schweinehalter bewusst sein, dass diese Form der Haltung hohe Ansprüche an das Management und die Mensch-Tier- Beziehung stellt.Schweine sind in der Freilandhaltung anspruchsvoller als beispielsweise Rinder. Sie benötigen ausreichend Futter und haben dabei einen höheren Eiweißbedarf als Wiederkäuer. Bei extensiver Mast im Freiland verlängert sich die Mastdauer, was höhere Kosten verursacht. Außerdem sind geeignete Rassen für die Freilandhaltung zu wählen, die jedoch meist fetteres Fleisch haben als intensive Mastrassen. Das führt wieder zu Preisabschlägen (Laister 2003).
4.1.4 Huhn und Ei
In der Haltung von Bio-Hühnern werden langsamer wachsende Rassen verwendet. Durch die Freilandhaltung können sich die Hühner ständig bewegen, ihr Fleisch ist dadurch besser durchblutet. Das Fleisch von Bio-Hühnern ist viel aromatischer und weniger wässrig als das von konventionell gehaltenen Hybridrassen.
Bio-Hühner werden artgerecht gehalten. Das heißt z.B. sie haben freien Auslauf mit Gebüschen und Bäumen als Schutz vor Greifvögeln, Scharr- und Sandbademöglichkeiten, Sitzstangen in unterschiedlicher Höhe und die Möglichkeit ihr Futter vom Boden aufzupicken. Sie werden in Familienverbänden mit Hahn gehalten.
Die meisten konventionellen Eier stammen noch immer aus Legebatteriehaltung. Bei Eiern wird mit vielen Begriffen geworben: es gibt Eier von glücklichen Hühnern (eine zwar schöne, aber inhaltlich wertlose Aussage), Eier aus Bodenhaltung (damit ist der Stallboden gemeint) und Eier aus Freilandhaltung (hier sind die Hühner zwar tatsächlich im Freien, allerdings werden sie konventionell ernährt). Der entscheidende Unterschied bei Eiern aus biologischer Landwirtschaft ist neben der artgerechten Tierhaltung (Freilandhaltung) die Fütterung mit Futter aus biologischem Anbau und das Verbot von Antibiotika.
Quelle: www.bio-erleben.at[1]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.bio-erleben.at
4.1.5 Fisch
In der EU-Verordnung 2092/91, die die rechtliche Grundlage und Mindestanforderung für die biologische Landwirtschaft in Österreich darstellt, ist der Bereich der biologischen Aquakultur bislang nicht geregelt. Regelungen dazu finden sich den Richtlinien mancher Bioverbände, wie beispielsweise beim Ernte-Verband oder beim Freiland-Verband. Im österreichischen Lebensmittelcodex finden sich im Kapitel A.8, Teilkapitel B Regelungen für die biologische Karpfenzucht.
In Österreich ist die "Arge Biofisch" ein wichtiger Ansprechpartner für diesen Bereich der Biolandwirtschaft. Diese Arbeitsgemeinschaft wurde 1994 gegründet. Sie vereint 14 Bio- Karpfenzuchtbetriebe und 7 Bio-Forellenbetriebe. Mit 300 ha Teichfläche sind das etwa 10% der gesamten Teichfläche Österreichs. Die "Arge Biofisch" setzt sich für die Grundsätze der biologischen Wirtschaftsweise auf dem Gebiet der Fischzucht ein.
In der biologischen Fischzucht sind folgende Praktiken verboten:
- Einsatz chemischer Wachstumsförderer
- Einsatz von Hormonen
- Anwendung von Gentechnik
- Einsatz synthetischer Zusatzstoffe in den Futtermitteln
- Anwendung von Spritz- und Düngemitteln
Quelle: www.biofisch.at[1]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.biofisch.at
4.1.6 Milch und Milchprodukte
Aufgrund des hohen Gebirgsanteils an der Gesamtfläche Österreichs hat die Haltung von Rindern und Milchvieh eine hohe Bedeutung in Österreich. Das Gras der Almen und Weiden kann vom Wiederkäuer Rind optimal verwertet werden. Somit steht das Rind in keiner Nahrungskonkurrenz zum Menschen, wie das beispielsweise beim Schwein der Fall ist.
Die Verarbeitung der Milch zu Käse und anderen Milchprodukten hat in Österreich eine lange Tradition. Milchprodukte werden gerne konsumiert. Im Jahr 2003 lag der Pro-Kopf-Konsum von Trinkmilch und Joghurt bei 78 Liter pro Jahr. Der Durchschnittsösterreicher isst außerdem 19,5 kg Käse pro Jahr (Daten AMA Marketing, 2003). Das Angebot an Milchprodukten in Naturkostläden umfasst nicht nur Kuhmilch, sondern auch Schaf- und Ziegenmilch und -milchprodukte. In Österreich arbeiten 15% der Milchbetriebe nach den Richtlinien der biologischen Landwirtschaft. 18% der Milchkühe leben auf Biohöfen (Zehetgruber 2004). Derzeit wird jedoch nur ein Teil der biologisch produzierten Milch auch tatsächlich als "Bio" vermarktet. Die restliche Milch wird ohne Bio-Preiszuschlag wie konventionell produzierte Milch vermarktet. Der Bio-Milchmarkt ist in den letzten zwei Jahren durch stagnierendes Wachstum und niedrige Erzeugerpreise gekennzeichnet (Schomborg 2004).
Nächstes Kapitel: 4.2 Produkte pflanzlicher Herkunft
Vorheriges Kapitel: 4.1 Produkte tierischer Herkunft
4.2 Produkte pflanzlicher Herkunft
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Das Bio-Angebot von Produkten aus pflanzlichen Rohstoffen umfasst:
- Gemüse
- Obst (und Trockenfrüchte, Nüsse - hier nicht näher besprochen)
- Hülsenfrüchte (hier nicht näher besprochen)
- Getreide und Getreideprodukte
- Kräuter und Gewürze
- Speiseöle (und Fette, hier nicht näher besprochen)
- Getränke
- Brotaufstriche und Marmeladen (hier nicht näher besprochen)
- Süßigkeiten und Konfekt (hier nicht näher besprochen)
Produkt wie Kaffee, Tee, Kakao und Schokolade sind zunehmend auch in Bio- und FairTrade[1]-Qualität erhältlich.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 11.2
Inhalt
4.2.1 Gemüse
Die Hauptanbaugebiete von Gemüse liegen in Nieder- und Oberösterreich, sowie der Steiermark und dem Burgenland. Man unterscheidet zwischen Feld- und Feingemüse. Die heimischen Bio-Gemüsebetriebe sind unterschiedlich strukturiert: Es gibt wenige gemischte Betriebe, weiters eine Reihe von spezialisierten Gärtnerbetrieben. Große Betriebe, die sich ganz auf die Gemüseproduktion spezialisiert haben, beliefern meist den Lebensmittelhandel. Die Vermarktung von Biogemüse erfolgt über Direktvermarktung, Naturkosthandel, Lebensmitteleinzelhandel, sowie über Abokisten-Systeme. Die Problemfelder liegen im Bereich der Vermarktung und der Produktion.
4.2.1.1 Kategorien
Unter Feldgemüse versteht man z.B. Zwiebel, Kraut, Karotten, Spargel und Melonen. Zum Feingemüse zählen beispielsweise Paradeiser, Paprika, Salat, Gurken, Porree und Melanzani. Erdäpfel stellen eine eigene Kategorie dar.
Während die Nachfrage nach Bio-Lagergemüse (Zwiebel, Kartoffel) zur Gänze mit heimischer Ware gedeckt werden kann, beträgt der Selbstversorgungsgrad Österreichs mit Feingemüse nur etwa 50%. Der restliche Bedarf muss durch Importe aus den Mittelmeerländern gedeckt werden.
4.2.1.2 Betriebe
Die österreichischen Bio-Gemüsebetriebe sind sehr unterschiedlich strukturiert: Gemischte Betriebe, die die Gemüseproduktion neben anderen Bereichen betreiben, sind eher selten. Hier handelt es sich oft um Direktvermarkter, die dadurch in ihrem Hofladen oder auf dem Bauernmarkt eine breitere Produktpalette anbieten können. Weiters gibt es eine Reihe von spezialisierten Gärtnerbetrieben, die meist über wenig landwirtschaftliche Nutzfläche verfügen, und die sie daher intensiv bewirtschaften. Sie produzieren eher Feingemüse. Durch die Verwendung von Folientunnels und Glashäusern können sie auch während der kälteren Jahreszeiten produzieren. Mengenmäßig am meisten Gemüse wird von spezialisierten Großbetrieben produziert, die hauptsächlich die Handelsketten beliefern. Einige dieser Betriebe kultivieren nur eine einzige Gemüseart.
4.2.1.3 Vermarktung
Die Direktvermarktung von Biogemüse ist in Österreich nahezu flächendeckend verbreitet. Das Gemüse wird entweder Ab-Hof[1] oder auf einem Markt[2] verkauft, oder es werden Bioläden[3] und Großküchen[4] beliefert. Eine besondere Form der Biogemüse-Vermarktung sind Abokisten-Systeme[5]: Hier können Kunden aus einer bestehenden Palette von verschiedenen Gemüsearrangements wählen, die sie regelmäßig, wie ein "Abo", zugestellt bekommen. Diese Vermarktungsform ist vor allem in und um Ballungszentren verbreitet.
Über den Lebensmitteleinzelhandel wird mengenmäßig viel Gemüse abgesetzt, jedoch mit einer eingeschränkten Produktpalette. In den Supermärkten[6] findet man in Bioqualität meist nur Erdäpfel, Zwiebel, Karotten, teilweise Paradeiser und Äpfel. Die Handelsketten beziehen ihr Gemüse vorwiegend von spezialisierten Großbetrieben. Im Bio-Fachhandel dominieren einige wenige Gemüsehändler, die Biosupermärkte[7] und Bioläden[3] beliefern.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 5.4.3
[2] Siehe Kapitel 5.4.1
[3] Siehe Kapitel 5.3
[4] Siehe Kapitel 6
[5] Siehe Kapitel 5.6.2
[6] Siehe Kapitel 5.2
[7] Siehe Kapitel 5.2.1
4.2.1.4 Problembereiche
Ein Problembereich im Bio-Gemüsesektor ist die Unsicherheit der Produktion. Die produzierten Gemüsemengen schwanken stark, sodass nach einer Produktionsspitze, in der die Preise verfallen, sehr plötzlich ein Produktionsengpass eintreten kann, da die Erntezeit vorbei ist. Der Markt wird von Experten daher als unstrukturiert beschrieben. Eine Abstimmung zwischen Angebot und Nachfrage ist kaum gegeben. Im Großhandel, der die Verbindung zwischen Produzenten und Handel (Geschäfte) darstellt, ist der Absatz aufgrund dieser schwankenden Produktion schwierig und stagniert oftmals.
Der Lebensmitteleinzelhandel (Supermarktketten) bildet eine Ausnahme: Hier werden genaue Lieferverträge direkt zwischen der Kette und einem Großproduzenten abgeschlossen, es gibt keine Zwischenhändler. Um jedoch eine Handelskette beliefern zu können, muss ein Betrieb entsprechend große Mengen liefern und daher hochspezialisiert produzieren. Ein weiteres Problem stellt die Produktion selbst dar. Besonders auf spezialisierten Betrieben, die sich auf den Anbau einer oder weniger Kulturen konzentrieren, gibt es Mängel in der Fruchtfolge. Spezialisierte Betriebe wirtschaften zudem meist viehlos, wodurch sie auf andere Möglichkeiten der Düngung angewiesen sind. Arbeitet ein Betrieb mit Tunnels, so steht er vor dem Problem der geringen Mobilität dieser Konstruktionen. Dadurch verringert sich die Rotation der Flächen, was eine Ermüdung der Böden nach sich zieht.
4.2.2 Obst
Die Hauptanbaugebiete von Obst liegen in der Steiermark, in Niederösterreich und im Burgenland. Beim Anbau von Bio-Obst überwiegen Kernobstsorten, allen voran Äpfel. Die großen Bio- Obstbetriebe in Österreich sind stark spezialisiert und werden ohne Tierhaltung betrieben. 90% des Bio-Kernobstes wird über die Bio-Absatzgemeinschaft vertrieben, die die Handelsketten und teilweise den Naturkosthandel beliefert. Aus Sicht der Experten im Bio-Obstbau liegen die größten Probleme im Pflanzenschutz.
4.2.2.1 Betriebe
Die großen Bio-Obstbetriebe in Österreich sind stark spezialisiert und werden ohne Tierhaltung betrieben. Sie liefern die meisten Mengen für die Vermarktung über den Lebensmittelhandel. Diese Betriebe produzieren meist Kernobst, allen voran Äpfel. Sie sind in der Bio-Absatzgemeinschaft organisiert, die 90% des Bio-Obstes vertreibt. Geringere Mengen an Bio-Obst wird auf gemischten Betrieben kultiviert. Das frische Obst wird hier meist direkt (Ab-Hof oder auf Bauernmärkten) verkauft oder am Betrieb weiterverarbeitet, beispielsweise zu Marmelade.
4.2.2.2 Vermarktung
90% des Bio-Obstes wird über die "Absatzgemeinschaft Bio-Obst"vertrieben. Diese Vermarktungsgemeinschaft wurde im Dezember 2003 gegründet und zählt derzeit etwa 50 Mitgliedsbetriebe. Die Absatzgemeinschaft vertreibt nur Kernobst. Sie arbeitet mit zwei Vertragsbetrieben zusammen: Frutura, die hauptsächlich an die Handelskette Spar liefert, und Steirerfrucht, die Billa und Merkur (Rewe-Konzern), sowie Adeg versorgt. Diese Vertragsbetriebe sind verantwortlich für Verpackung, Sortierung und Lagerung. Die Handelsketten beziehen den größten Anteil des Bio-Obstes der Absatzgemeinschaft. Nur kleine Chargen oder Partien, die der Handel nicht beziehen will, werden an den Naturkosthandel geliefert.
Derzeit kann in Österreich der Bedarf an Bio-Obst nicht aus der Inlandsproduktion gedeckt werden. Nur 30 bis 40% stammen aus heimischem Bioanbau. Der Rest wird hauptsächlich aus Italien (Südtirol) importiert. Außerdem kann Bio-Obst nicht flächendeckend im Lebensmittelhandel Österreichs angeboten werden, sodass das Angebot auf die hochpreisigen Märkte, also die Filialen in den Ballungszentren, konzentriert wird. Durch das geringe Angebot an heimischem Bio-Obst ist die Preislage für die Produzenten gut. Schon ab 8 ha Obstfläche kann ein Betrieb im Vollerwerb wirtschaften (Bio Ernte Austria 2004).
4.2.2.3 Problembereiche
Aus Sicht der Experten im Bio-Obstbau liegen die größten Probleme im Pflanzenschutz. Im konventionellen Obstanbau werden im großen Umfang in großer Anzahl hochwirksame, chemisch- synthetische Pflanzenschutzmittel angewendet, die natürlich aufgrund ihrer Giftigkeit in der biologischen Landwirtschaft verboten sind.
Manche Schädlinge sind in der intensiven Bioproduktion kaum in den Griff zu bekommen. Aus diesem Grund gibt es daher kaum großen Bio-Kirschen- oder -Zwetschkenkulturen. Werden diese Früchte auf größeren Flächen in Reinkultur angebaut, kommt es zu einer starken, schlecht regelbaren Vermehrung gewisser Schädlinge. Ein weiteres Problem ist die größere Abhängigkeit von der Witterung. Gerade Blatt- und Fruchtschorf (eine Krankheit, die zu Flecken auf der Frucht führt, sodass das Obst nicht frisch vermarktet werden kann) treten gehäuft auf, wenn es viele Niederschläge gibt.
Außerdem führt Alternanz der Sorten zu stark schwankenden Produktionsmengen. Unter Alternanz versteht man große Schwankungen in den Erträgen, die bis hin zu kompletten Ernteausfällen im Obstgarten führen können. Daher benötigt der Bio-Obstbau konstante Sorten, die jährlich gleichbleibende Erträge liefern.
4.2.3 Getreide und -produkte
Zu den Getreidearten gehören Weizen (Weichweizen und Hartweizen), Roggen, Gerste, Dinkel & Grünkern (= in Milchreife geernteter und gedarrter Dinkel), Hafer, Hirse, Reis und Mais. Zwei alte Getreidearten sind Emmer und Einkorn, die "Vorfahren" des Weizens. Heute werden sie vereinzelt wieder angebaut.
Vollkornmehl und -schrot und Getreideflocken sind wichtige Elemente der Vollwertküche. Die wertvollen Inhaltsstoffe des ganzen Kornes bleiben dabei erhalten, denn gerade in der Randschicht des Kornes und im Keimling finden sich die wertvollsten Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Im Auszugsmehl sind diese Stoffe nicht mehr enthalten, auch die für die Verdauung wichtigen Ballaststoffe nicht. Waren ursprünglich Bio-Getreide[1]produkte ausschließlich Vollkornprodukte, so gibt es jetzt auch Bio-Auszugsmehl (weißes Mehl) und geschälten Reis. Weitere Getreideprodukte sind Brot und Backwaren, Müsli, Mehlspeisen, Kekse, Nudeln und Polenta. Malz aus Bio-Gerste wird zur Bier- und Getreidekaffeeherstellung verwendet. Bio-Getreide (z.B. Gerste, Mais, Hafer) ist auch ein wichtiges Futtermittel in der Biologischen Tierhaltung.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 7.1.2
4.2.4 Getränke
Es gibt im Naturkostfachhandel ein großes Angebot an Bio-Fruchtsäften und Bio-Gemüsesäften. Die meisten Bio-Fruchtsäfte sind Direktsäfte, das heißt sie werden gepresst, kurz geschleudert um grobe Trübstoffe abzutrennen und kurz pasteurisiert um besser haltbar zu sein. Nach der EU-VO[1] 2092/91[2] ist das Filtrieren und Klären für Fruchtsäfte ebenso zulässig wie auch das Verwenden von Fruchtsaftkonzentraten. In der Praxis sind die meisten Bio-Säfte im Naturkostladen jedoch naturtrübe Direktsäfte, da die meisten Verbandsrichtlinien strengere Vorgaben haben. Die künstliche Vitaminzufuhr und der Zusatz anderer Stoffe ist auch in der EU-Verordnung nicht erlaubt.
Eine spezielle Art der Gemüsesäfte sind milchsauer vergorene Gemüsesäfte. Durch die Milchsäuregärung werden Nährstoffe aufgeschlossen und dadurch besonders gut verdaulich.
Das Bio-Angebot bei alkoholischen Getränken umfasst vor allem Bio-Wein und Bio-Bier. Im Bio- Weinbau ist eine ganzjährige Begrünung der Weingärten vorgeschrieben. Es gibt strenge Regelmentierungen bei den Zusatz- und Hilfsstoffen bei der Kellerarbeit. Mehrfach international ausgezeichnete Bio-Weine kommen beispielsweise vom Betrieb der Familie Zillinger[3] im Weinviertel. Für Bio-Bier dürfen bei der Herstellung keine Schnellgärmethoden, Klärhilfsmittel und Bieraromen zur Geschmackskorrektur verwendet werden.
Quelle: www.naturkost.de[4]
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2.1
[2] Siehe Kapitel 2.1
[3] Siehe Kapitel 7.1.1
[4] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.naturkost.de
4.2.5 Kräuter und Gewürze
Im Naturkosthandel ist ein komplettes Kräuter- und Gewürzangebot in Bio-Qualität erhältlich. Neben den gängigen Küchenkräutern (Dill, Oregano, Majoran, ...) und Gewürzen (Paprika, Pfeffer, Chili, Curry, ...) werden auch innovative und sehr dekorative Gewürzmischungen angeboten (z.B. "Energie" eine Gewürz-Blütenmischung aus Paprika, Knoblauch, Chili, Rosenblüten, Oregano, Thymian, Basilikum, Rosmarin, Pfeffer, Sonnenblumen- und Ringelblumenblüten, von der Waldviertler Firma Sonnentor[1]).
Bio-Kräuter und -Gewürze sind frisch und getrocknet erhältlich. Bio-Topfkräuter (Schnittlauch, Basilikum, Melisse, Estragon, Petersilie, ...) gibt es nicht nur in Naturkostläden, sondern mittlerweile auch in Supermärkten. In Österreich werden Kräuter und Gewürze vor allem in der Steiermark, im Waldviertel, im Weinviertel und im Mühlviertel (Bergkräutergenossenschaft[2] Hirschbach) produziert. Der Anbau ist (vor allem in der Steiermark und im Mühlviertel) kleinflächig und mit viel Handarbeit verbunden.
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.sonnentor.at
[2] Siehe Kapitel 7.2.2
4.2.6 Speiseöle
Pflanzenöle enthalten Kohlenhydrate und Eiweiße, Enzyme, Vitamine und Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe und Fettsäuren. Vor allem die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind besonders wertvolle Inhaltsstoffe. Für die Eigenschaften und Qualität der Öle ist sind neben der Pflanzenart die Art der Pressung, Aufbewahrung und Frische entscheidende Faktoren.
Die Liste der Speiseölsorten aus Biologischem Anbau, die im gut sortierten Naturkostfachhandel angeboten werden, ist lang: Olivenöl, Sonnenblumenöl, Weizenkeimöl, Maiskeimöl, Distelöl, Leinöl, Kürbiskernöl, Mohnöl, Sojaöl, Sesamöl, Rapsöl, Erdnußöl, Mandelöl, Haselnußöl, Walnußöl, ...
Bei der Sortenwahl sollte man nicht nur den Geschmack, sondern auch die Eignung der Öle berücksichtigen. Die wertvollen ungesättigten Fettsäuren werden bei hohen Temperaturen zerstört und können dann gesundheitsschädliche Transfettsäuren bilden. Natives Sonnenblumenöl, Distelöl oder Leinöl z.B. sollte man nicht hoch erhitzen, sondern nur kalt (z.B. für Salate) verwenden (der Begriff "nativ" bedeutet, dass die Öle mechanisch gepresst wurden und nicht erwärmt und nachbehandelt wurden).
Quelle: Pfeiffer 2005
Nächstes Kapitel: 4.3 Convenience-Produkte
Vorheriges Kapitel: 4.2 Produkte pflanzlicher Herkunft
4.3 Convenience-Produkte
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Convenience-Produkte ist die Bezeichnung für Halbfertig- und Fertigprodukte. Beispiele für Halbfertigprodukte sind vorgeschälte Erdäpfel, geputztes und geschnittenes Gemüse oder verschiedene Teigarten wie Strudel- und Blätterteig. Solche halbfertigen Produkte werden besonders auch in der Großküchenverpflegung eingesetzt, da sie viel Arbeitszeit einsparen.
Fertigprodukte wie Pizza, Knödel, Laibchen, fertig zubereitete Strudel oder Soßen werden oft als Tiefkühlprodukte angeboten. Auch KonsumentInnen greifen verstärkt zu diesen Waren. Viele Bio-KonsumentInnen stehen dieser Art von Produkten skeptisch gegenüber. Der Energiebedarf für die nötigen Verarbeitungsschritte und ein meist erhöhter Verpackungsaufwand stehen im Gegensatz zum ursprünglichen Bio-Ideal. Der klare Vorteil von Bio-Convenience zu herkömmlichen Fertigprodukten ist die Einschränkung der erlaubten Zusatzstoffe. Solche Stoffe sind sonst gerade in hoch verarbeiteten Produkten in hohem Ausmaß zugesetzt. Bei Bioprodukten gibt es detaillierte Positivlisten der erlaubten Zusätze, die in der EU-VO 2092/91[1] festgehalten sind.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2.1
Nächstes Kapitel: 4.4 Non-Food-Produkte
Vorheriges Kapitel: 4.3 Convenience-Produkte
4.4 Non-Food-Produkte
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Produkte und Rohstoffe aus Biologischem Anbau werden nicht nur für Lebensmittel verwendet. Auch in anderen Bereichen - Bekleidung, Körperpflege und Kosmetik, Waschen und Reinigen - gibt es gesunde und umweltverträgliche Alternativen zu herkömmlichen Produkten des täglichen Bedarfs. Besonders umfangreich ist die Produktpalette und die Zahl der Herstellerfirmen im Bereich der Naturkosmetik und der Naturtextilien.
Anders als im Lebensmittelbereich durch die EU-VO 2092/91[1] sind bei Naturkosmetika und Naturtextilien die Produktionsrichtlinien nicht gesetzlich verbindlich geregelt. Die Regelung und Kontrolle der Weiterverarbeitung ist hier wesentlich komplizierter als bei Lebensmitteln, da - vor allem bei den Textilien - mehrstufige, komplexere und auf viele Unternehmen aufgeteilte Produktionsschritte vorliegen. Es gibt jedoch auf privatrechtlichen Richtlinien und Kontrollen beruhende Prüfzeichen.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2.1
Inhalt
4.4.1 Naturkosmetik
Warum Naturkosmetik? Substanzen, die wir auf die Haut auftragen, werden vom Körper aufgenommen. Gesundheitsgefährdende Substanzen in Kosmetika sind daher ebenso problematisch wie Schadstoff- und Pestizidrückstände in Lebensmitteln. Herkömmliche Kosmetika können z.B. Substanzen enthalten, die Allergien auslösen können, krebsverdächtig sind oder vom Körper nicht abgebaut werden. Kosmetika können durch die Verwendung von Rohstoffen aus gentechnisch veränderten Pflanzen gentechnisch veränderte Bestandteile enthalten. Durch aufwändige Verpackung und durch die Verwendung von Erdöl als Ausgangsprodukt für synthetisch hergestellte Rohstoffe trägt auch die Kosmetikindustrie zur Umweltverschmutzung bei. Ein ethisches Problem stellen Tierversuche für Kosmetika bzw. deren Ausgangsprodukte dar.
Eine Alternative zur herkömmlichen Kosmetik bietet das ständig erweiterte und mittlerweile sehr umfangreiche Produktsortiment an Naturkosmetika. Unter Naturkosmetik versteht man Kosmetik aus natürlichen Rohstoffen pflanzlichen, tierischen oder mineralischen Ursprungs. Ausnahmen gibt es bei einzelnen Konservierungsstoffen, die verhindern sollen, dass die Produkte auch während des Gebrauchs nicht verderben. Synthetische Stoffe, die in der herkömmlichen Kosmetik eingesetzt werden (wie z.B. synthetische Farbstoffe, chemische UV-Filter, Paraffine, ...) und gentechnisch veränderte Rohstoffe werden nicht verwendet.
Quelle: Piringer und Hartl (o.J.)
4.4.1.1 Rohstoffe
Naturkosmetika bestehen mit wenigen Ausnahmen bei den Hilfsstoffen (bestimmte Konservierungsstoffe) aus natürlichen Rohstoffen pflanzlicher, tierischer und mineralischer Herkunft. Wichtige Rohstoffe sind Pflanzenöle und -fette (z.B. Jojobaöl, Wildrosenöl, Nachtkerzenöl, Sheabutter) und ätherische Öle, gewonnen z.B. aus Lavendel, Neroli und Rosmarin. Verwendet werden auch Pflanzenextrakte (Karottenextrakt, Mimosenblütenextrakt, ...) und Auszüge aus Kräutern und Wurzeln (Stiefmütterchen, Melisse, Iriswurzel, ... ). Hydrolate (das sind Nebenprodukte bei der Destillation von ätherischen Ölen) und Mazerate (Auszüge von Blüten und Kräutern in Basisölen) sind ebenfalls wichtige pflanzliche Rohstoffe. Tierische Rohstoffe sind z.B. Bienenwachs, Propolis und Honig.
4.4.1.2 Produkte und Hersteller
Das Naturkosmetik-Produktsortiment umfasst:
- Dekorative Kosmetik (Make up, Lippenstift, Wimperntusche, ...)
- Gesichtspflege (Reinigungsmilch, Gesichtswässer, Anti-Ageing-Cremes, ...)
- Körperpflege (Duschgels, Massageöle, Badezusätze, ...)
- Sonnenpflege (Sonnenschutzcremes, Sun-Blocker, After-Sun-Lotions, ...)
- Haarpflege (Shampoos, Pflanzenhaarfarben, Haarspray, ...)
- Nagelpflege (Nagellack, Nagellackentferner, ...)
- Babypflege (Shampoos, Cremes, Öle, ...)
- Parfüms, Eau de Toilettes, Deodorants
- Aftershaves, Rasiercremen
- Zahnpasta
- Mückenschutz
Bekannte Naturkosmetikhersteller, deren Produkte auch in Österreich erhältlich sind, sind z.B. Weleda[1]], Logona[2]], Lavera[3]], Martina Gebhardt [4]und Primavera Life[5]. Als Beispiele für österreichische Produzenten seien die Firma Sanoll [6]aus Tirol oder die Steirische Firma Ringana[7] genannt.
Quelle: Piringer und Hartl (o.J.)
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.weleda.com/
[2] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.logona.com
[3] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.lavera.de
[4] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de
[5] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.primavera-life.de
[6] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.sanoll.at
[7] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.ringana.com
4.4.1.3 Vermarktung
Naturkosmetik ist in Naturkostläden[1], Bio-Supermärkten[2], Reformhäusern und Apothekenerhältlich. Es gibt auch einzelne Fachgeschäfte, die ausschließlich Naturkosmetik führen. Andere Vermarktungswege sind der Versandhandel über Kataloge oder internet, vereinzelt finden sich auch Produkte in Drogeriemärkten. Im konventionellen Handel ist es nicht leicht, in der Fülle des Angebotes von Produkten, die mit Begriffen wie "Pflanzlich", "Natürlich", "Kräuter" und üppigen Naturbildern werben, seriöse Naturkosmetik herauszufinden. Eine gute Beratung gibt es in Reformhäusern und Naturkosmetikfachgeschäften.
Quelle: Piringer und Hartl (o.J.)
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 5.3
[2] Siehe Kapitel 5.2.1
4.4.1.4 Richtlinien für Naturkosmetik
Gerade im Kosmetikbereich gibt es sehr viele Produkte, die mit Begriffen wie "Natur", "pflanzliche Wirkstoffe", "Kräuter", "Bio" und der entsprechend blumig-natürlichen Verpackungsgestaltung den Eindruck erwecken, Naturkosmetika zu sein. Eine EU-Richtlinie für Naturkosmetik ähnlich wie die VO (EWG) 2092/91[1] für Lebensmittel aus biologischem Landbau gibt es leider noch nicht. In Österreich ist jedoch im österreichischen Lebensmittelcodex[2] definiert, was mit dem Begriff "Naturkosmetik" bezeichnet und verkauft werden darf. Weiters gibt es das Gütesiegel "kontrollierte Naturkosmetik", das auf den privatrechtlichen Richtlinien eines deutschen Herstellerverbandes basiert. Beide Regelungen schreiben derzeit nicht zwingend, sondern "soweit als möglich" Rohstoffe aus biologischem Landbau vor.
Quellen: Piringer und Hartl (o.J.)
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2.1
[2] Siehe Kapitel 2.2
4.4.1.4.1 Österreichischer Lebensmittelcodex
Im österreichischen Lebensmittelcodex[1] (Österreichisches Lebensmittelbuch, Codexkapitel B 33 „Kosmetische Mittel“, Teilkapitel „Naturkosmetik“), wird der Begriff Naturkosmetik definiert und ein entsprechender Standard festgelegt. Nur Produkte, die diesen Standards entsprechen, dürfen als "Naturkosmetik" bezeichnet werden.
Die wesentlichen Kriterien sind zusammengefasst:
- Naturkosmetika bestehen (mit wenigen Ausnahmen bei Hilfsstoffen) aus natürlichen Rohstoffen pflanzlichen, tierischen und mineralischen Ursprungs. Die Rohstoffe sollen so weit als möglich aus biologischem Anbau stammen.
- Als Hilfsstoffe sind nur bestimmte im Codex aufgelistete Konservierungsmittel, sowie aus natürlichen Rohstoffen hergestellte Emulgatoren und Tenside zugelassen. Konservierungsmittel sind deshalb erlaubt, damit die Produkte nicht nur im originalverpackten Zustand, sondern auch während des Gebrauchs nicht verderben.
- Bei den Verarbeitungsmethoden gibt es Einschränkungen: erlaubt sind nur physikalische, mikrobiologische und enzymatische Verfahren. Gentechnische Verfahren und die radioaktive Bestrahlung von Rohstoffen und Endprodukten sind verboten.
- Der Einsatz von synthetischen Duftstoffen, synthetischen Farbstoffen, Silikonen und ethoxilierten Rohstoffen ist verboten.
Quellen: Piringer und Hartl (o.J.)
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2.2
4.4.1.4.2 "Kontrollierte Naturkosmetik" - eine privatrechtliche Richtlinie
Der deutsche Herstellerverband BDIH (Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflege) entwickelte die Richtlinie und das Prüfzeichen "kontrollierte Naturkosmetik". Die Einhaltung wird von einem unabhängigen Prüfinstitut kontrolliert und auf den Produkten mit dem Zeichen des BDIH dokumentiert.
In einigen Punkten sind die Anforderungen der Richtlinie höher als im Teilkapitel Naturkosmetik des Österreichischen Lebensmittelcodex. So sind z.B. weniger Konservierungsstoffe zugelassen. Nicht erlaubt sind außerdem Stoffe die von toten Wirbeltieren stammen. Andererseits sind Verfahren erlaubt, die im Codex nicht enthalten sind, z.B. die Hydrierung als Verfahren zur Herstellung von Emulgatoren und Tensiden aus Naturstoffen. Die Unterschiede sind jedoch nicht gravierend.
Quellen: Piringer und Hartl (o.J.), www.kontrollierte-naturkosmetik.de[1]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de
4.4.2 Naturtextilien
Die Herstellung herkömmlicher Textilien ist ein komplexer, auf viele Verarbeitungsschritte und Produktionsstandorte aufgeteilter Prozess. Vor allem der hohe umwelt- und gesundheitsschädigende Chemikalieneinsatz in der konventionellen Baumwollproduktion und in der Textilveredlung wird von Umweltschutz- und Konsumentenschutzorganisationen kritisiert. Durch die stark arbeitsteilige, globale Produktionsweise ist das Transportaufkommen sehr hoch.
Auch soziale Mißstände kennzeichnen die textile Produktionskette. Organisationen wie die Clean Clothes Campagne[1]bemühen sich um eine Verbesserung der miserablen Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie der Schwellen- und Entwicklungsländern. Naturtextilien sind eine Alternative zu dieser wenig umwelt- und sozialverträglichen Produktionsweise.
Naturtextilien sind Textilien aus Naturfasern, deren Anbau und Weiterverarbeitung bestimmten Kriterien entspricht. Synthetikfasern werden außer in Ausnahmefällen, wie z.B. Elastan in Damenstrumpfhosen, nicht eingesetzt. Da die Textilherstellung ein komplexer Produktionsprozess ist, in dem bei herkömmlichen Textilien sehr viel "Chemie" eingesetzt wird, ist es notwendig die Verarbeitungsprozesse nach umweltverträglichen und gesundheitsverträglichen Kriterien zu definieren.
Quelle: Hartl und Vogl 2001
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.cleanclothes.org
4.4.2.1 Rohstoffe
Der mengenmäßig bedeutendste Faserrohstoff, der in Bio-Qualität für Naturtextilien verwendet wird, ist Bio-Baumwolle. Eine Besonderheit ist die farbig gewachsene Baumwolle - Baumwolle, deren Fasern nicht weiß, sondern in verschiedenen Braun- und Grüntönen ausgebildet sind.
Andere Fasern, die bereits in Bio-Qualität erhältlich sind und für Naturtextilien verwendet werden, sind Leinen, Hanf, Schafwolle, Cashmere und Seide.
Der Großteil der Naturtextilien ist mit synthetischen Farben gefärbt. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, Farbstoffe aus Pflanzen zu gewinnen. Der Anteil an pflanzengefärbten Textilien ist aber nach wie vor sehr gering.
Quelle: Hartl und Vogl 2001
4.4.2.1.1 Pflanzenfarben
Unter Pflanzenfarben versteht man Farbstoffe, die aus Pflanzen gewonnen werden. Der Anbau, die Farbstoffgewinnung und die Färberei mit Pflanzenfarben war vor der Erfindung der synthetischen Farben Mitte des 19. Jahrhunderts ein nicht unbedeutender Wirtschaftszweig. Bekannt ist vor allem Indigoblau, das aus dem subtropisch-tropischen Indigostrauch, dem japanischen Färberknöterich oder auch dem im Europa früher kultivierten Färberwaid hergestellt wurde. Rote Farbe wurde aus den Wurzeln des Färberkrapp gewonnen. Gelbe Farbstoffe sind in vielen Pflanzen enthalten, in Europa war die Färberresede am bedeutendsten.
Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es Forschungsprojekte, die die Wiedereinführung des Anbaus und der Färbung mit Färbepflanzen zum Ziel haben. Geforscht wird zu Anbauverfahren, Selektion von Pflanzen, Farbstoffextraktionsmethoden und industriellen Färbemethoden. Der Sprung in die Umsetzung und Anwendung in der Praxis im industriellen Maßstab ist noch nicht geschafft. Derzeit sind pflanzengefärbte Produkte aus kunsthandwerklicher Herstellung erhältlich.
Quelle: Hartl und Vogl 2001
4.4.2.1.2 Bio-Baumwolle
Die Baumwolle ist mengenmäßig die bedeutendste Naturfaser zur Herstellung von Bekleidung. Trotz des natürlichen Images der Baumwolle ist die herkömmliche Produktionsweise des Rohstoffs mit schwerwiegenden negativen Folgen für Mensch und Umwelt verbunden. Kritisiert wird vor allem der hohe Pestizideinsatz, der zu Vergiftungs- und Todesfällen bei den Bauern führt, Wasser und Nahrungsmittelkulturen kontaminiert und das natürliche Artenspektrum verändert. Weiter Folgen des Baumwollanbaus sind der hohe Wasserverbrauch, der Verlust an Biodiversität und an Anbauflächen für Nahrungsmittel durch den Anbau in Monokultur, der Verlust von Bodenfruchtbarkeit und das Auftreten von Erosionsschäden.
Die Anzahl an Biobaumwollproduzenten und Umstellungsprojekten steigt. Dies zeigt, dass ein nachhaltiger Anbau von Baumwolle im biologischen Landbau möglich und auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Die Hauptproduktionsländer von Biobaumwolle sind derzeit Türkei und USA. Weitere wichtige Länder sind Indien, Peru, Uganda, Ägypten, Senegal und Tansania. Trotzdem ist Bio- Baumwolle nach wie vor ein Nischenprodukt: erst weniger als 0,1% der Baumwollproduktion insgesamt stammen aus biologischem Anbau.
Die Förderung des biologischen Baumwollanbaus hat sich der Arbeitskreis Organic Cotton des Pestizid Aktions-Netzwerks (PAN Germany[1]) zum Ziel gesetzt. Zu den Aktivitäten dieses Arbeitskreises gehören:
- Beratung von Firmen und Organisationen, die auf Bio-Baumwolle umstellen wollen
- Betreuung einer Datenbank von Produzenten, Hersteller und Handelsunternehmen von Bio- Baumwolle bzw. Bio-Baumwoll-Produkten
- Seminare, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Baumwolle, Naturtextilmarkt und - labels
- Netzwerkarbeit und Organisation von Tagungen
Quellen: Hartl und Vogl 2001, Enquete-Kommission des deutschen Bundestages 1994, Ton 2002, www.pan-germany.org
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.pan-germany.org
4.4.2.2 Produkte und Hersteller
Das Produktsortiment von Naturtextilien ist sehr umfangreich und umfasst alle Bereiche der herkömmlichen Textilien:
- Damen- und Herrenmode
- Baby- und Kindermode
- Unterwäsche
- Nachtwäsche
- Heimtextilien und Bettwaren
- Accessoires
- Schuhe und Lederwaren
Bekannte Naturtextilhersteller sind z.B. Consequent[1]] oder Sekem[2]. In Deutschland findet zweimal jährlich eine eigene Fachmesse für Naturtexilien, die InNaTex[3] (Internationale NaturTextilmesse) statt.
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.consequent.org
[2] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.sekem.com
[3] https://web.archive.org/web/2005*/http://innatex.de
4.4.2.3 Vermarktung
In Österreich sind Naturtextilien schwer erhältlich. Der konventionelle Textilhandel führt Naturtextilien nicht. Die Auswahl an spezialisierten und kompetenten Naturtextilfachgeschäften ist gering. Ein paar Geschäfte gibt es in Wien, Perchtoldsdorf, Linz, Salzburg, Graz und Hohenems. Naturkostläden bieten - wenn überhaupt - nur ein sehr kleines Sortiment von Wäsche oder Babybekleidung.
Ein großes Angebot von Naturmode gibt es über den Versandhandel. Eine seit vielen Jahren marktführende und innovative Firma ist der deutsche Versandhandel hess natur[1], der auch nach Österreich liefert.
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://at.hess-natur.com
4.4.2.4 Richtlinien für Naturtextilien
Eine EU-weite Regelung wie die EU-VO 2091/92[1] im Lebensmittelbereich gibt es für Naturtextilien noch nicht, wohl aber privatrechtliche Regelungen und Prüfzeichen, die von unabhängigen Kontrollinstitutionen vergeben werden. Seriöse Prüfzeichen sind "Naturtextil IVN zertifiziert" und "Naturtextil IVN zertifiziert best" vom Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft[2] (IVN).
Die Richtlinien des Internationalen Verbands der Naturtextilwirtschaft ' umfassen die gesamte Produktionskette vom Rohstoff bis zum Endprodukt. Sie definieren
- Art und Produktionsweise der Rohstoffe,
- Verfahren und Chemikalien, die in der Weiterverarbeitung eingesetzt bzw. nicht eingesetzt werden dürfen,
- Grenzwertregelungen für Schadstoffrückstände im Endprodukt sowie
- Sozialstandards für Arbeitsbedingungen.
Die Zertifizierung durch eine unabhängige Püfinstitution beruht auf regelmäßigen Betriebsprüfungen und stichprobenartigen Kontrollen der Ware (Rückstandsanalysen). Es wurde ein Prüfzeichen in zwei Abstufungen entwickelt: "Naturtextil IVN zertifiziert best" (blau) hat die höchsten Anforderungen, "Naturtextil IVN zertifiziert" (orange) hat etwas geringere Anforderungen hinsichtlich Rohstoffproduktion und Weiterverarbeitung. Bei den Faserrohstoffen z.B. sind bei "best" ausschließlich Rohstoffe aus biologischer Landwirtschaft bzw. Umstellung erlaubt. "IVN zertifiziert" schreibt nur bei Baumwolle bio-Qualität bzw. Umstellungsware vor und läßt bei den anderen Faserrohstoffen auch konventionell erzeugte zu.
Quelle: Hartl und Vogl 2001, www.naturtextil.com
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2.1
[2] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.naturtextil.com
Vorheriges Kapitel: 4.4 Non-Food-Produkte
5 Vermarktungsformen
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Biologisch erzeugte Lebensmittel sind aufgrund der dynaischen Entwicklung von Angebot und Nachfrage in den 90-er Jahren mittlerweile leicht erhältlich und werden in den verschiedensten Formen vermarktet. Bis vor zehn Jahren wurden Bioprodukte in Fachgeschäften wie Naturkost- und Reformläden oder direkt von den Landwirten (Ab-Hof oder über Bauernmärkte) verkauft. Seit dem Einstieg der großen Handelsketten in die Biovermarktung im Jahr 1994 hat der Verkauf von Bioprodukten im Supermarkt große Bedeutung gewonnen. Eine neue Entwicklung sind eigene Bio-Supermärkte, die ein Vollsortiment an Naturkost und Naturwaren in Bio-Qualität im Stil eines Supermarktes anbieten.
Bioprodukte werden auch über Hauszustellung und über Internet-Shopping vermarktet. Eine innovative Vermarktungsform mit hohem Erlebniswert für die KonsumentInnen ist das Prinzip der Selbsternte.
Quellen: mündliche Auskünfte verschiedener VertreterInnen der AMA-Marketing GmbH im November 2004
Inhaltsverzeichnis
Weitere Kapitel dieser Lernunterlage
1 Was ist Biologische Landwirtschaft?
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Gründerväter
4 Produktpalette
6 Gastronomie und Grossküchen
7 Erzeuger
8 Aufbereiter (Verarbeiter)
9 Bioverbände
10 Konsumenteninformation
11 Aktuelle Entwicklungen
12 Diskussionsfelder
13 Glossar
14 Quellen
Nächstes Kapitel: 5.1 Entwicklung der Vermarktung
Vorheriges Kapitel: 5 Vermarktungsformen
5.1 Entwicklung der Vermarktung
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Bis vor zehn Jahren wurden Bioprodukte in Fachgeschäften wie Naturkost- und Reformläden oder direkt von den Landwirten verkauft. Seit dem Einstieg der großen Handelsketten in die Biovermarktung im Jahr 1994 hat diese Vermarktungsform Bedeutung gewonnen. Heute werden in Österreich etwa 60-70% der Bioprodukte im Lebensmittelhandel über die großen Handelsketten verkauft. Daneben haben Naturkost- und Reformläden heute einen geringeren Anteil an der Vermarktung: 10% der Bioprodukte werden im Naturkosthandel und über Direktvermarktung abgesetzt. Jeweils 15% entfallen auf den Export und die Außer-Haus- Verpflegung inklusive Gastronomie (vgl. Dietachmair, Ernte 3/2004).
In den letzten zehn Jahren sorgten vor allem die Lebensmittelketten für das Wachstum in der Bio- Vermarktung. Aktuell sind es jedoch die Bereiche Gemeinschaftsverpflegung und Großküchen[1] sowie Export, die Zuwächse in der Vermarktung bringen. In diesen Bereichen liegt ein großes Potenzial. Ein sehr vielseitiges Angebot findet sich auch in der Direktvermarktung von Bioprodukten.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 6
Nächstes Kapitel: 5.2 Supermärkte
Vorheriges Kapitel: 5.1 Entwicklung der Vermarktung
5.2 Supermärkte
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna HartlIm Jahr 1994 stiegen die Handelsketten Billa und Merkur mit ihrer Bio-Eigenmarke "Ja!Natürlich" in die Vermarktung von Bioprodukten ein. Etwa ein Jahr später startete auch die Lebensmittelkette Sparmit der Eigenmarke "Natur pur" ihre Bio-Vermarktung. Andere Handelsketten folgten, wie ADEG mit "Bio+" und Hofer mit "Natur Aktiv" im Jahr 2002. Nach der anfänglichen Skepsis bezüglich dieses Absatzkanals gerade für Bioprodukte sind diese mittlerweile fixer Bestandteil des Sortiments jeder wichtigen Handelskette.
Im Jahr 2003 wurden 60% der Bioprodukte über den Lebensmitteleinzelhandel (LMEH) abgesetzt. 2001 erreichte der Bio-Absatz in diesem Sektor einen Höchststand. Dieser Boom, der 25% Zuwachs im Lebensmittelhandel brachte, wurde durch die BSE-Krise ausgelöst. Nicht nur Bio-Fleisch und -Wurstprodukte erreichten dadurch einen höheren Anteil, auch alle anderen Warengruppen profitierten. Seit dem Jahr 2002 ist der Bio-Markt im LMEH mengenmäßig konstant, auf den Wert bezogen jedoch leicht rückläufig. Derzeit sind es andere Absatzkanäle, die für Zuwächse in der Bio-Vermarktung sorgen: Die Bio-Großküchenverpflegung und der Export von Bio- Produkten nehmen zu.
Das Sortiment der großen Handelsketten ist jedoch eingeschränkt: Nur etwa 2 bis maximal 10% der Artikel einer Warengruppe sind Bioprodukte. Dabei bieten alle Handelsketten im wesentlichen dieselben Produkte an. Frischmilch, Butter, Joghurt, Erdäpfel und Karotten gehören zum Standard-Biosortiment jeder Handelskette. Selbst wenn Konsumenten mehr Bioprodukte kaufen möchten, ist dies in den Supermärkten der Handelsketten kaum möglich. Die notwendige Vielfalt fehlt hier (vgl. Mayr 2004 und Dietachmair 2004).
Inhalt
5.2.1 Bio-Supermärkte
Eine neue Entwicklung stellen die Biosupermärkte dar. Diese verkaufen ausschließlich Bioprodukte und bieten ein umfangreiches Vollsortiment in der Dimension eines Supermarktes an. Das Angebot umfasst nicht nur Bio-Lebensmittel, sondern auch Naturkosmetik, Öko-Waschmittel, Literatur, etc. Ein Beispiel für einen Bio-Supermarkt ist der Biomarkt Maran[1].
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.biomarkt.co.at
Nächstes Kapitel: 5.3 Naturkostläden
Vorheriges Kapitel: 5.2 Supermärkte
5.3 Naturkostläden
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna HartlEine breite Palette an Biolebensmitteln wird im spezialisierten Naturkosthandel angeboten. Das gesamte Sortiment besteht hier aus Bioprodukten und Naturwaren (wie beispielsweise Naturkosmetik). Der Anteil des Naturkosthandels an der Bio-Vermarktung liegt jedoch nur bei etwa 10%.
Unter Naturkost versteht man die Ernährung mit Lebensmitteln in möglichst naturbelassener Form. Bioprodukte werden diesem Anspruch am besten gerecht. Naturkost ist eine Sammelbezeichnung für Lebensmittel, die
- aus biologischer Landwirtschaft stammen,
- möglichst vollwertig und frisch sind,
- ohne chemisch-synthetische Zusatzstoffe weiterverarbeitet werden und
- gewisse ethische Kriterien erfüllen: sie sollen fair und sozial verträglich verarbeitet und gehandelt sein.
Die heimischen Naturkost-Fachgeschäfte bieten ein Vollsortiment an Bioprodukten. Außerdem verstehen sich Naturkostläden als kompetente Beratungsstellen für biologische Produkte und natürliche Ernährung. Organisiert sind die Naturkostläden im VNÖ.
Inhalt
5.3.1 VNÖ
Seit 1999 gibt es einen Dachverband für Naturkostläden: Der VNÖ (Verein zur Förderung und Entwicklung des Naturkostfachhandels in Österreich) vereint die Interessen von etwa 45 österreichischen Naturkostläden. Das Vollsortiment dieser Geschäfte wird im Auftrag des Dachverbandes VNÖ von staatlich autorisierten Bio-Kontrollstellen überprüft und muß aus kontrolliert biologischem Anbau stammen. Andere Produkte dürfen nur angeboten werden, wenn es diese nicht in biologischer Qualität gibt (Quelle: www.vnoe.at[1]).
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.vnoe.at
Nächstes Kapitel: 5.4 Direktvermarktung
Vorheriges Kapitel: 5.3 Naturkostläden
5.4 Direktvermarktung
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna HartlEin sehr vielseitiges Angebot findet sich auch in der direkten Vermarktung von Bioprodukten. Bei der Direktvermarktung tritt der Produzent, also der Biobauer, in Kontakt mit dem Käufer. Entweder werden die Produkte am Betrieb ("Ab-Hof", z.B. im Hofladen[1]) oder auf Bauernmärkten verkauft, oder es erfolgt eine Belieferung der Käufer. Das Sortiment ist in diesem Fall eingeschränkt, da ein einzelner Betrieb nicht alle Produktgruppen abdecken kann. Durch den Zusammenschluss mehrerer Produzenten zu Erzeugergemeinschaften kann die Produktpalette ausgeweitet werden.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 5.4.2
Inhalt
5.4.1 Bauernmärkte
Auf Bauernmärkten treten die Produzenten der Waren in direkten Kontakt mit den Kunden. Neben dem direkten Nutzen des Verkaufs kann hier aktive Kundenbetreuung verwirklicht und ein Bezug zwischen Menschen hergestellt werden. Außerdem ermöglicht diese Art der Vermarktung die Weitergabe einer Fülle von Informationen und Botschaften. Diese Aspekte sind besonders für die Vermarktung von Bioprodukten von großer Bedeutung, da sich viele Menschen von der Biolandwirtschaft mehr erwarten als die bloße Produktion von Nahrungsmitteln.
Auf immer mehr Bauernmärkten finden sich Marktstände von Biobauern. Manche Märkte verfügen über ein so genanntes "Bio-Eck", einem Bereich, der Bio-Marktständen vorbehalten ist. Außerdem gibt es spezialisierte Bio-Bauernmärkte, auf denen ausschließlich Bioprodukte verkauft werden. Bauernmärkte haben nur einen geringen Anteil am Gesamtabsatz von Bioprodukten. Es gibt jedoch ein Potential für eine Belebung dieser Vermarktungsform, da wieder mehr Menschen das besondere Einkaufserlebnis eines Marktes schätzen.
5.4.2 Hofläden
Unter einem Hofladen versteht man ein Geschäft am landwirtschaftlichen Betrieb, in dem vorwiegend die hofeigenen Produkte, aber auch zugekaufte Waren verkauft werden. Die Erreichbarkeit von Hofläden ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Die Nähe zu Ballungszentren oder Fremdenverkehrsregionen ist hier von großem Vorteil. Weiters ist der hohe Arbeitsaufwand zu beachten, da während der Öffnungszeiten ständig eine Arbeitskraft anwesend sein muss. Im Hofladen findet eine besonders intensive Begegnung mit den Kunden statt, da diese den Biobetrieb persönlich kennen lernen und erfahren, woher ihre Waren stammen. Daher ist eine ansprechende Gestaltung des Ladens sowie des gesamten Betriebes besonders bedeutend.
5.4.3 Ab-Hof
Unter "Ab-Hof-Verkauf" versteht man den Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen direkt am Betrieb. Dafür kann ein eigener Raum oder ein Hofladen am Betrieb eingerichtet sein. Die Kunden rufen entweder an, um die gewünschten Produkte vorzubestellen und einen Zeitpunkt für die Abholung zu vereinbaren, oder sie kommen einfach vorbei. Bei dieser Form der Vermarktung ist es notwendig, dass jederzeit ein/e Betriebsangehörige/r für eventuelle Kunden zur Verfügung steht. Eine weitere Form des Ab-Hof-Verkaufes ist der Straßenverkauf, der besonders von Betrieben an stark frequentierten Verkehrsstrecken (beispielsweise im niederösterreichischen Weinviertel) betrieben wird. Hier bieten meist ältere Betriebsangehörige, die schon in Pension sind, verkaufsfertige Produkte direkt an der Straße an.
Nächstes Kapitel: 5.5 Internet Shopping
Vorheriges Kapitel: 5.4 Direktvermarktung
5.5 Internet Shopping
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna HartlEine neue Form der Vermarktung ist der Vertrieb von Bioprodukten via Internet. Über einen online- Katalog können je nach Sortimentsumfang Bio-Lebensmittel und Naturwaren aus Rohstoffen aus biologischem Anbau im internet bestellt und per Versand bezogen werden. Ein Beispiele aus Deutschland für diese Art der Vermarktung ist 'www.der-bioladen.de'[1]. "www.der-bioladen.de" ist die online-Weiterentwicklung eines Bioladens in Westerburg. Über den Online-Shop werden seit dem Jahr 2000 Naturkost und Naturwaren angeboten. Das Sortiment umfasst derzeit etwa 2000 Artikel wie z.B. Lebensmittel (Brot, Gemüse, Feinkost, Kaffee, Aufstriche, Kindernahrung, Müsli, Öle, Fertiggerichte, etc.), Naturkosmetik, Naturheilmittel, Tiernahrung, Getreidemühlen, Wasch-, Putz- und Spülmittel. Beliefert wird ganz Deutschland via Versand.
Quelle: www.der-bioladen.de
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.der-bioladen.de
Nächstes Kapitel: 5.6 Hauszustellung
Vorheriges Kapitel: 5.5 Internet Shopping
5.6 Hauszustellung
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Bei einer Hauszustellung werden die bestellten Produkte dem Kunden an die gewünschte Adresse zugestellt. Die Bestellung erfolgt telefonisch, per Fax oder Post sowie via E-Mail. Außerdem haben die meisten Bio-Hauszusteller für ihre Kunden eine Internetseite eingerichtet, sodass auch Bestellungen über den Internet-Shop möglich sind.
Die Hauszustellung ist auf eine bestimmte Region im Umkreis des Zustellbetriebes beschränkt. Meist werden Ballungszentren und ihre Umgebung beliefert. Je nach Zustellfirma erfolgt die Belieferung an bestimmten Tagen in der Woche. Dabei muss ein Bestellschluss eingehalten werden, um die Produkte kommisionieren, das heißt für den Kunden individuell zusammenstellen zu können. Außerdem muss die Zustelltour eingeteilt werden. Die Belieferung erfolgt bis ins Haus bzw. in die Wohnung. Dafür wird von manchen Zustellfirmen eine Zustellgebühr in Rechnung gestellt. Die Bezahlung erfolgt entweder bar, mit Kreditkarte, durch Einzahlung oder mittels Bankeinzug. Beispiele für diese Art der Vermarktung sind der Biowichtl und das Adamah Biokistl.
Inhalt
5.6.1 Biowichtl
Ein Hauszustell-Service mit Vollsortiment ist beispielsweise der "Biowichtl[1]". Dieses Unternehmen beliefert Kunden im Raum Wien und Linz. Außerdem werden ausgewählte Bioprodukte, die sich dafür eignen, auch per Versand verschickt. Das Sortiment umfasst Obst und Gemüse, Getreide und -produkte, Fleisch, Milch und -produkte, Gewürze, Getränke, Knabbereien, Kosmetik- und Hygieneartikel sowie Waschmittel.
Quelle: www.biowichtl.at
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.biowichtl.at
5.6.2 Adamah Biokistl
Eine Spezialform der Hauszustellung ist das Kisten-Abo. Hier kann der Kunde aus fertig zusammengestellten Arrangements, den sogenannten "Kisten", wählen. Als Beispiel ist hier der Biohof Adamah[1] (Arbeitsgemeinschaft Familie Zoubek) in Glinzendorf im Marchfeld (Niederösterreich) zu nennen. Der Betrieb bietet Gemüse- und Obstkisten in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten an. Der Kunde erhält bis auf Widerruf wöchentlich, immer am selben Tag, sein Kisten-Abo.
Neben Biogemüse und -obst werden auch andere Produkte angeboten. Dabei arbeitet der Biohof Adamah mit anderen Erzeugergemeinschaften und Verarbeitungsbetrieben zusammen. Beispielsweise verarbeitet die Bäckerei Waldherr bei Eisenstadt das Adamah-Getreide zu Brot und Backwaren. Von den Hoflieferanten werden Säfte, Milchprodukte, Wurst und bratfertige Hühner bezogen.
Quelle: www.adamah.at
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.adamah.at
Nächstes Kapitel: 5.7 Selbsternte
Vorheriges Kapitel: 5.6 Hauszustellung
5.7 Selbsternte
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl"Selbsternte[1]" ist ein innovative Vermarktungsform mit hohem Erlebniswert für die KonsumentInnen. Es geht dabei nicht nur um ein vielfältiges gesundes Angebot von Bio-Gemüse und Kräutern, sondern auch um das sinnliche Erleben und Kennenlernen von Wachstum, Pflege und Ernte dieser Pflanzen.
Die Selbsternte basiert im Prinzip auf einer Arbeitsteilung zwischen Bio-Bauern und KonsumentInnen: die Landwirte bauen in Reihen mehr als 20 verschiedene Gemüse- und Kräuterarten an und teilen diese dann quer zur Laufrichtung der Reihen, sodass Mischkulturparzellen entstehen. Diese enthalten jeweils mehrere Meter der verschiedenen Gemüse- und Kräuterarten. Im Mai werden die fertig bebauten Parzellen an die "Selbsternter" übergeben und von ihnen bis zum Herbst gepflegt und beerntet. Der Preis für eine Parzelle richtet sich nach der Größe und dem zusätzlichen Pflegemaßnahmen, die von den Landwirten durchgeführt werden (100 - 195 € pro Parzelle). Die Parzellenflächen werden von staatlich autorisierten Bio- Kontrollstellen einmal pro Jahr überprüft. Selbsternteparzellen gibt es mittlerweile in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark.
Selbsternte ist nicht nur der Fachbegriff für eine spezielle Vermarktungsform, sondern auch eine eingetragene Bild- und Text-Handelsmarke. Bio-Bauern, die unter dem Label "Selbsternte" Parzellen anbieten, zahlen dafür Lizenzgebühr an das Selbsterntebüro. Das Selbsterntebüro bietet dafür auch Fachberatung und Kurse für Landwirte und Konsumenten an. Ein Auszug aus der Kulturartenvielfalt einer Selbsternteparzelle: Paradeiser, Kohlrabi, verschiedene Salate, rote Rüben, Porree, Pfefferoni, Speisekürbisse, Erdäpfel, Brokkoli, Karotten, Radieschen, Fisolen, Zucchini, Gurken, Sellerie, Zwiebel, Erbsen, Mangold, verschiedene Kräuter, ...
Quelle: www.selbsternte.at, Vogl und Axmann 2002
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.selbsternte.at
Vorheriges Kapitel: 5.7 Selbsternte
6 Gastronomie und Grossküchen
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna HartlSehr dynamisch ist die Entwicklung des Einsatzes von Bioprodukten in Großküchen und Gastronomiebetrieben. Mehr Bewusstsein der Konsumenten und der Wunsch nach gesunder Ernährung hat die Nachfrage nach biologischen Produkten auch in diesem Bereich erhöht. Die landwirtschaftlichen Produzenten konnten ihr Auftreten professionalisieren und ihre Logistik verbessern, was ebenfalls eine Ausweitung des Bio-Angebotes in der Außer-Haus-Verpflegung bewirkte.
Großküchen stellen andere Ansprüche an die Versorgung mit Lebensmitteln als Privathaushalte. Die Wahl geeigneter Lieferanten und Handelspartner hat in diesem Sektor zentrale Bedeutung. Biologische Produkte findet man mittlerweile in den Küchen von Bio-Hotels, einer Reihe von Restaurants und verstärkt auch in der Gemeinschaftsverpflegung.
Quelle: mündliche Auskunft von Karin Kaiblinger im November 2004 (Bio Ernte Austria, Großküchen)
Inhaltsverzeichnis
Weitere Kapitel dieser Lernunterlage
1 Was ist Biologische Landwirtschaft?
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Gründerväter
4 Produktpalette
5 Vermarktungsformen
7 Erzeuger
8 Aufbereiter (Verarbeiter)
9 Bioverbände
10 Konsumenteninformation
11 Aktuelle Entwicklungen
12 Diskussionsfelder
13 Glossar
14 Quellen
Nächstes Kapitel: 6.1 Entwicklung
Vorheriges Kapitel: 6 Gastronomie und Grossküchen
6.1 Entwicklung
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Bis vor wenigen Jahren wurden Bio-Lebensmittel in der sogenannten "Außer-Haus-Verpflegung" praktisch nicht verwendet. Als Gründe wurden hohe Kosten und die geringe Verfügbarkeit von Bioprodukten in der erforderlichen Quantität angeführt. In den letzten Jahren konnte die Bio- Vermarktung in diesem Segment jedoch kräftig zulegen. Mittlerweile erreicht der Umsatz mit Bioprodukten in Großküchen 30 Mio. Euro jährlich. Das Marktpotenzial wird auf das Zehnfache geschätzt (Kaiblinger, Zehetgruber 2004).
Im Jahr 2003 betrug der Umsatz mit Bioprodukten in österreichischen Großküchen 30 Mio. Euro (Kaiblinger, Zehetgruber 2004). Im Vergleich dazu: Der Gesamtumsatz österreichischer Bio- Lebensmittel beträgt 400 Mio. Euro. Rechnet man den Umsatz der Bio-Großküchenverpflegung und von Bioprodukten in der Gastronomie zusammen, so erreicht die Außer-Haus-Verpflegung mit Bioprodukten einen Anteil von 15% am Gesamtabsatz von Bio-Lebensmitteln (Dietachmair 2004). Und die Tendenz ist weiter steigend. Großküchen zählen heute zu den Bio- Hoffnungsmärkten.
Nächstes Kapitel: 6.2 Ansprüche der Großküchen
Vorheriges Kapitel: 6.1 Entwicklung
6.2 Ansprüche der Großküchen
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna HartlGroßküchen haben andere Ansprüche an die Lebensmittelversorgung als Privathaushalte:
- Die Produkte müssen in der benötigten Vielfalt und Quantität zur Verfügung stehen.
- Der Aufwand für die Organisation des Einkaufes soll möglichst gering sein, damit Arbeitszeit gespart werden kann.
- Die gelieferten Produkte sollen professionell vor- oder aufbereitet sein. Gewaschene, geschnittene oder geschälte Lebensmittel bis hin zu Halbfertig- und Fertigprodukten werden verstärkt gewünscht.
Nächstes Kapitel: 6.3 Lieferanten für Großküchen
Vorheriges Kapitel: 6.2 Ansprüche der Großküchen
6.3 Lieferanten für Großküchen
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Als Großabnehmer benötigen Gastronomiebetriebe und Großküchen eine breite Palette von Produkten in der entsprechenden Quantität. Die Belieferung durch einzelne Landwirte gestaltet sich aufwändig. Daher wurden spezialisierte Firmen gegründet, die den Vertrieb und die Logistik von Bioprodukten übernehmen. Ein Beispiel ist die Firma Bio-Gast mit Sitz in Langenzersdorf. Auch der Ernte-Verband hat eine Servicestelle aufgebaut: Das Bio Ernte GV & Gastro-Service.
Eine Alternative zu professionellen Firmen stellen Erzeugergemeinschaften dar. Hier treten die Produzenten in direkten Kontakt mit den Großküchen, ohne dass Zwischenhändler beteiligt sind. Erzeugergemeinschaften entstehen durch den Zusammenschluss mehreren Produzenten, wodurch eine breitere Produktpalette angeboten werden kann. Spezifische Aufgabenbereiche wie Akquisition, Verhandlungsführung, Organisation der Logistik und die Kundenbetreuung können in der Gemeinschaft besser verteilt werden. Den Großküchen steht so immer ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Die Gründung von Erzeugergemeinschaften erfordert jedoch viel Engagement und Eigeninitiative, sowie hohe Kooperationsbereitschaft zwischen den Landwirten (Umweltberatung 2000).
Nächstes Kapitel: 6.4 Bio-Hotels
Vorheriges Kapitel: 6.3 Lieferanten für Großküchen
6.4 Bio-Hotels
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Mit dem Ziel ausschließlich Bio-Lebensmittel anzubieten hat sich eine Gruppe von Hoteliers im Verein "Die Bio-Hotels[1], Verein für Angebotsentwicklung und Marketing" zusammengeschlossen. Jedes Bio-Hotel hat einen Kontrollvertrag mit einer vom Verein Die Bio-Hotels genannten Bio- Kontrollstelle abzuschließen. Diese kontrolliert die Einhaltung der EU-VO 2092/91 und der ergänzenden Vereinsrichtlinien. Bei Verstößen gegen diese Standards können Sanktionen verhängt werden. Diese sind in vier Stufen unterteilt: Von der Klärung einer geringfügigen Abweichung innerhalb einer Frist bis zum Ausschluss aus dem Verein.
Grundsätzlich stammen alle verwendeten Produkte (Essen und Getränke) aus biologischer Erzeugung. Ausnahmen werden für die Gäste klar ersichtlich deklariert und sind nur im Rahmen eines vom Verein vorgegebenen Schemas möglich. Dieses Schema gibt für Getränke die Mindestanzahl des Bio-Anteils an (z.B.: mindestens 5 Sorten Biotee im Teesortiment). Bei Speisen ist die Verwendung eines konventionellen Lebensmittels nur zulässig, wenn dieses nicht in biologischer Qualität erhältlich ist. Das Ziel der Bio-Hotels ist es, ausschließlich Bioprodukte mit großer Auswahl in Gourmet-Qualität anzubieten.
Im Jahr 2001 wurde das Hotel Schweitzer in Tirol als erstes Hotel in Europa nach der EU-VO 2092/91 zertifiziert. Damit setzte es den Anfang für die Entwicklung der Bio-Hotels. Im selben Jahr wurde der Verein Die Bio-Hotels, Verein für Angebotsentwicklung und Marketing offiziell gegründet. 2002 sind zwölf Betriebe Mitglieder im Verein. Die Marke "Bio-Hotel" wird vom Patentamt registriert. Vier Betriebe aus Deutschland und ein Hotel aus Südtirol kommen im Jahr 2002 als Mitglieder hinzu. 2003 erregt der Beitritt der Therme Blumau zu den Bio-Hotels großes mediales Aufsehen. Dieses Hotel ist jedoch 2004 als Mitglied wieder ausgetreten. Aktuell sind 24 Hotelbetriebe in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien Mitglieder des Vereines. Das System der Bio-Hotels soll nun auf angrenzende Länder, wie Italien, Slowenien und die Schweiz übertragen werden.
Quelle: www.biohotels.at
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.biohotels.at
Nächstes Kapitel: 6.5 Biorestaurants
Vorheriges Kapitel: 6.4 Bio-Hotels
6.5 Biorestaurants
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna HartlLebensmittel aus biologischer Landwirtschaft werden in verschiedenen Gastronomiebetrieben eingesetzt. Sie werden in der Speisekarte korrekt mit der Bezeichnung "aus (kontrolliert) biologischer/ökologischer Landwirtschaft" ausgewiesen. Die Richtigkeit dieser Angabe muss nachvollziehbar sein.
Es gibt auch Restaurants, die sich auf die Verwendung von Bioprodukten spezialisiert haben und ausschließlich oder überwiegend Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft verwenden. Ein Beispiel ist das Bio-Vollwertrestaurant Dreiklang.
Inhalt
6.5.1 Restaurant Dreiklang
Im Dreiklang[1] wird seit über 13 Jahren täglich frisch und vor allem biologisch-vollwertig gekocht. Die Speisen werden ohne Mikrowelle, abwechslungsreich und überwiegend vegetarisch zubereitet. Für Fleischliebhaber gibt es ausschließlich Bio-Freiland-Fleisch. Das Speisenangebot wechselt mit dem landwirtschaftlichen Jahreskreislauf. Im Dreiklang werden fast ausschließlich Produkte aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft verkocht. Frischgemüse, Eier, Fleisch, Getreide, Obst wird von inländischen Biobauern bezogen, in der kalten Jahreszeit auch von ausländischen Bio- Betrieben. Der Seminarraum "FreiRaum" direkt neben dem Lokal ist stunden- oder tageweise zu mieten und für Gruppen bis max. 30 Personen geeignet für Workshops, Meetings, Ausstellungen, etc. Auch ein Bio-Catering wird nach Vereinbarung angeboten.
Das Restaurant Dreiklang wurde bereits im Jänner 2000 mit dem österreichischen Umweltzeichen für Tourismus ausgezeichnet. Beispiele für die Dreiklang-Umweltmaßnahmen:
- Keine Portionsverpackungen im Lebensmittelbereich.
- Mülltrennung wird von Anfang an praktiziert.
- Getränke aller Art werden fast ausschließlich in Mehrwegflaschen angeboten.
- Es werden fast ausschließlich Produkte aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft verwendet.
- Frischgemüse, Eier, Fleisch, Getreide, Obst wird hauptsächlich von inländischen Bio-Bauern bezogen.
- Das Speisenangebot wechselt mit dem landwirtschaftlichen Jahreskreislauf.
- Es gibt keine Friteuse, daher kein Altspeiseöl.
- Keine Mikrowelle.
- Im Sanitärbereich wurden umweltschonenden Maßnahmen gesetzt: Sensor-Armaturen, WC mit Wasserstopp, Recyclingpapier.
- Fahrradständer vor dem Lokal.
- Ökostrombezug seit Jänner 2004.
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.3klang.info
Nächstes Kapitel: 6.6 Gemeinschaftsverpflegung
Vorheriges Kapitel: 6.5 Biorestaurants
6.6 Gemeinschaftsverpflegung
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna HartlUnter Gemeinschaftsverpflegung versteht man die Verpflegung von Personen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Heimen, Krankenhäusern, Kasernen oder Kantinen.
Durch Landtagsbeschlüsse in den verschiedenen Bundesländern konnte der Anteil an Bio- Lebensmitteln in den Großküchen der Landeseinrichtungen (z.B. Krankenhäuser, Kasernen, Schulen, Wohnheime) angehoben werden. In Niederösterreich und Wien hat der Bio-Anteil hier mittlerweile 30% erreicht. Um diesen Erfolg weiterhin zu sichern, müssen langfristige Kooperationen und Investitionen sichergestellt werden. In den Bundesländern wird vor allem die Kooperation mit öffentlichen Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen weiter ausgebaut werden. Dies erfordert konsequentes Lobbying in der Politik.
Gründe für diese Entwicklung sind das gestiegene Bewusstsein der Konsumenten und der Wunsch nach gesunder Ernährung, wodurch sich die Nachfrage nach biologischen Produkten auch in diesem Bereich erhöht hat. Die landwirtschaftlichen Produzenten konnten ihr Auftreten professionalisieren und ihre Logistik verbessern (Umweltberatung 2000). Der politische Wille zur Ökologisierung der Verpflegung in öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen war ebenfalls ein wesentlicher Faktor. Durch Landtagsbeschlüsse der Bundesländer konnten mittlerweile Bio-Anteile von 25% und mehr in der Gemeinschaftsverpflegung der einzelnen Länder erreicht werden.
Vorheriges Kapitel: 6.6 Gemeinschaftsverpflegung
7 Erzeuger
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Erzeuger von biologischen Produkten sind landwirtschaftliche Betriebe, die nach den gesetzlichen Richtlinien zur biologischen Landwirtschaft produzieren. Es gibt sehr unterschiedliche Biobetriebe. Auch in der biologischen Landwirtschaft gibt es neben kleinen Betrieben ausgesprochene Großbetriebe mit 100 Hektar Nutzfläche und mehr. Betriebe, die mehrere Produktionsbereiche als Standbein nutzen finden sich genauso wie hoch spezialisierte Produzenten.
Eine Erzeugergemeinschaft entsteht durch den Zusammenschluss mehrerer Biobauern. Die Zusammenführung der verschiedenen Produkte der einzelnen Betriebe bietet Handelspartnern eine breite Produktpalette. Außerdem können dadurch Aufgaben in der Gemeinschaft verteilt werden. Die Gründung und erfolgreiche Durchführung eines solchen Zusammenschlusses erfordert viel Engagement und Kooperationsbereitschaft.
Inhaltsverzeichnis
Nächstes Kapitel: 7.1 Der Blick auf Bio-Bauernhöfe Österreichs
Vorheriges Kapitel: 7 Erzeuger
7.1 Der Blick auf Bio-Bauernhöfe Österreichs
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
In Österreich gibt es 19.056 Bio-Betriebe, die zusammen eine Fläche von 326.703 ha bewirtschaften (Zahlen für 2003, laut Grüner Bericht 2004, Quelle: www.land.lebensministerium.at[1], 24.05.2005).
Die Bio-Betriebe sind hinsichtlich ihrer Größe, ihres Produktangebotes und ihrer Vermarktungsstrategien sehr unterschiedlich. Ein Beispiel für einen international erfolgreichen Bio- Weinbauern ist der Betrieb der Familie Zillinger. Der Biohof Kettler ist ein Beispiel für einen Betrieb, der sich auf viehlosen Ackerbau spezialisiert hat. Ein Bio-Betrieb, der eine breite Palette von Gemüse (auch alte Kultursorten), Kräutern, Getreide und Ölsaaten anbaut und vermarktet, ist der Biohof Adamah[2] der Arbeitsgemeinschaft Familie Zoubek.
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.land.lebensministerium.at
[2] Siehe Kapitel 7.1.3
Inhalt
Weitere Kapitel dieser Lernunterlage
1 Was ist Biologische Landwirtschaft?
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Gründerväter
4 Produktpalette
5 Vermarktungsformen
6 Gastronomie und Grossküchen
8 Aufbereiter (Verarbeiter)
9 Bioverbände
10 Konsumenteninformation
11 Aktuelle Entwicklungen
12 Diskussionsfelder
13 Glossar
14 Quellen
7.1.1 Ein Bio-Weinbauer
Die Familie Zillinger aus Velm-Götzendorf im südlichen Weinviertel ist seit vielen Jahren für die hohe Qualität ihrer Weine bekannt. Im Jahre 1673 wurde der Familienbetrieb gegründet. Schon 1985 wurde der gesamte Betrieb auf organisch-biologischen Landbau umgestellt. Für die Forschungsarbeiten am Bioweinsektor wurde Familie Zillinger mit dem NÖ-Umweltpreis ausgezeichnet. Es folgten Auszeichnungen im Rahmen verschiedener Wein-Prämierungen, darunter auch mehrere Goldmedaillen für die Auszeichnung als weltbester Bio-Wein auf der BioFach Nürnberg.
Der Betrieb ist über die Jahre stetig gewachsen und umfasst heute 15ha Weinfläche. Außerdem werden 40ha Ackerland bewirtschaftet. 65% der Weingärten sind mit Rotweinsorten bepflanzt, da die Nachfrage groß ist und der Erfolg der Rotweine für sich spricht. Das ist eine Besonderheit im östlichen Weinviertel, da hier überwiegend Weißwein kultiviert wird.
Der Wein wird zu ca. 55% über den Wiederverkauf vermarktet, also in Naturkostläden, Hofläden, Vinotheken und Biosupermärkte. Außerdem werden 7% über das Internet (an Privatkunden) verkauft. 5% der Vermarktung laufen über Gastronomiebetriebe (hauptsächlich Biohotels und - restaurants). Die restlichen ca. 30% wird an Privatpersonen verkauft, und zwar entweder mittels direkter Zustellung oder mit Paketdienst. Das Sortiment umfasst derzeit 16 Weißweine, 10 Rotweine und 2 Süßweine. Auf dem Betrieb werden auch Weinseminare abgehalten.
Quelle: www.zillinger.at[1]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.zillinger.at
7.1.2 Ein Bio-Getreidebauer
Der Biohof Kettler in Peigarten im Weinviertel hat sich auf den biologischen Ackerbau spezialisiert. Der viehlose Betrieb wird seit 1987 biologisch bewirtschaftet. Er ist Mitglied des Vereins "Organisch-biologischer Ackerbau Weinviertel", einem regionalen Bio-Verband mit etwa 20 Mitgliedern.
Der Schwerpunkt der Produktion am Biohof Kettler liegt auf dem Anbau von Getreide. Außerdem werden Leguminosen (Erbsen), sowie Sonnenblumen, Ölkürbis und andere Ölfrüchte kultiviert. Nach der Ernte wird das Erntegut einem Lohnunternehmen zur Reinigung und Bearbeitung (z.B. Schälen oder Polieren) übergeben. Der Verkauf der Bioprodukte erfolgt in Bauernläden, Naturkostläden und auf Bauernmärkten. Der Lebensmitteleinzelhandel wird nicht beliefert. Vermarktet werden zu 90% Produkte des eigenen Betriebes. Nur bei zu geringen Erntemengen wird von Biobetrieben aus der Region zugekauft.
Der Betrieb wird viehlos bewirtschaftet. Das bedeutet, dass kein Wirtschaftsdünger wie beispielsweise Stallmist zur Düngung der Äcker zur Verfügung steht. Die Zufuhr von Nährstoffen erfolgt über eine ausgewogene Fruchtfolge, die zu je einem Drittel aus Getreide, Leguminosen und Alternativkulturen wie Sonnenblumen oder Ölkürbis besteht. Die Düngung erfolgt über Flächenkompostierung: Die nach der Ernte verbliebenen Pflanzenreste werden in den Acker eingearbeitet, ebenso wie Luzerne, die zur Gründüngung angebaut wird.
7.1.3 Ein Bio-Gemüsebauer
Der Biohof Adamah[1] der Arbeitsgemeinschaft Familie Zoubek in Glinzendorf (Marchfeld) in Niederösterreich baut verschiedenste Sorten von Biogemüse und -Kräutern an. Daneben werden ebenso Getreide und Ölsaaten kultiviert und verarbeitet. Die Arbeitsgemeinschaft betreibt einen Hofladen am Betrieb und bietet ein Hauszustellservice[2] für Kunden in Wien und Umgebung an.
Außerdem werden die Produkte auf Bauernmärkten verkauft und Naturkostläden beliefert. Neben gebräuchlichen Gemüsesorten werden auch wenig verbreitete Pflanzen oder alte Kultursorten angebaut. Dadurch bietet der Hof eine besonders breite Gemüsepalette. Die angebauten Sorten sind bevorzugt ältere und Nicht-Hybrid-Sorten, die nach ihrem Geschmack ausgewählt und durch eigene Auslese erhalten und an den Standort angepasst werden. Die Arbeitsgemeinschaft bietet auch verarbeitete Produkte wie eingelegtes Gemüse, getrocknete Gewürzkräuter, Öle und Getreideprodukte an.
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.adamah.at
[2] Siehe Kapitel 5.6.2
Nächstes Kapitel: 7.2 Der Blick auf Bio-Erzeugergemeinschaften
Vorheriges Kapitel: 7.1 Der Blick auf Bio-Bauernhöfe Österreichs
7.2 Der Blick auf Bio-Erzeugergemeinschaften
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Eine Erzeugergemeinschaft entsteht durch den Zusammenschluss mehrerer Biobetriebe. Die Gründung und erfolgreiche Durchführung erfordert viel Engagement und Kooperationsbereitschaft, hat jedoch viele Vorteile durch die Nutzung von Synergien. Je nach Schwerpunkt und Ausrichtung der Erzeugergemeinschaft kann die Zusammenarbeit folgende Bereiche umfassen:
- Erweiterung der Produktpalette durch Zusammenführung der verschiedenen Produkte der einzelnen Betriebe
- Aufgabenteilung und Spezialisierung innerhalb der Erzeugergemeinschaft
- Entwicklung von Know-how, z.B. bei Anbauverfahren für neue Kulturen
- Aufteilung der Investitionskosten und gemeinschaftliche Nutzung von Spezialmaschinen und Aufbereitungsanlagen
- Kooperation bei der Weiterverarbeitung von Produkten
- Qualitätskontrolle
- gemeinsame Vermarktung
Beispiele für Erzeugergemeinschaften sind Die Hoflieferanten und die Bergkräutergenossenschaft Hirschbach.
Inhalt
7.2.1 Die Hoflieferanten
Die Bio-Erzeugergemeinschaft Die Hoflieferanten[1] ist ein Zusammenschluss von mehreren Biobauern aus Oberösterreich. Die Gemeinschaft betreibt 3 Bioläden in der Region, bietet Bio-Catering an und beliefert mittels eines eigenen Vertriebes Großküchen, Gastronomiebetriebe und Geschäfte in der Region.
Eines der wichtigsten Prinzipien neben der biologischen Wirtschaftsweise ist die regionale Vermarktung der Produkte. Die Herstellung der Produkte erfolgt im Rahmen bäuerlicher Produktion auf den Betrieben der Gemeinschaft. So gibt es in der Gemeinschaft eine Hofmolkerei und eine Hofbäckerei. Weiters werden Fleisch- und Wurstprodukte sowie Fruchtsäfte hergestellt und vermarktet. Jeder der Produzenten ist mit Name und Adresse nachvollziehbar. Der unmittelbare Bezug zum Bio-Bauern als Qualitätsgarant ist das Markenzeichen des Angebotes. Das Sortiment der Hoflieferanten beinhaltet naturbelassene Milchprodukte, Getreide, Brot und Backwaren, Fleisch- und Wurstprodukte, Geflügel, Eier und Fruchtsäfte.
- File:Jpg350x280px
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.diehoflieferanten.at
7.2.2 Bergkräutergenossenschaft Hirschbach
Die Bergkräutergenossenschaft wurde 1986 als Selbsthilfe von Mühlviertler Bergbauernbetrieben gegründet, die in der ihrer Region nach Produktionsalternativen und Möglichkeiten der Existenzsicherung suchten. Sie spezialisierten sich auf Anbau und Vermarktung von Bio- Kräutern und Kräuterprodukten. Das Ziel war vollwertige Lebensmittel herzustellen. Die Kräuter werden auf 500 - 900 m Seehöhe überwiegend in Handarbeit angebaut und zeichnen sich dadurch durch hohe Qualität aus. Die 37 Betriebe werden vom organisch biologischen Landesverband Oberösterreich kontrolliert.
Der größte Teil der Kräuter stammt aus dem Mühlviertel. Um das Angebot zu erweitern werden zusätzlich auch Bio-Kräuter und -Gewürze importiert, die in Österreich nicht wachsen (z.B. Pfeffer) oder nicht in den erforderlichen Mengen angebaut werden (z.B. Kamille). Die Herkunft der Produkte wird auf der Verpackung deklariert. Die Produktpalette umfasst verschiedenste Kräutertees, Gewürze, Kräuterbäder & Kräuterkissen, Kräuteressig & -öle sowie Geschenkideen wie z.B. Briefpapier.
Quelle: www.bergkraeuter.at[1]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.bergkraeuter.at
Vorheriges Kapitel: 7.2 Der Blick auf Bio-Erzeugergemeinschaften
8 Aufbereiter (Verarbeiter)
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Rohstoffe aus Biologischer Landwirtschaft (z.B.: Milch, Fleisch, Obst, Gemüse) werden von vielen verschiedenen Betriebn aufbereitet/verarbeitet (z.B. zu Käse, Wurst, Saft oder Tiefkühlkost). Stand am Beginn der Entwicklung des Biologischen Landbaus die bäuerliche oder kleingewerbliche Verarbeitung im Vordergrund, so spielen heute mit der Zunahme von Angebot und Nachfrage immer mehr große, industrielle Verarbeiter eine zentrale Rolle. Kleine wie große Verarbeiter (Molkerein, Fleischverarbeitungsbetriebe, Mühlen, Bäckerein, etc.) unterliegen ebenso den Richtlinien des Biologischen Landbaus[1] und damit der Kontrolle und Zertifizierung, wie die Produzenten, Transport, Lagerung und Handel.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2
Vorheriges Kapitel: 8 Aufbereiter (Verarbeiter)
9 Bioverbände
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Die Entwicklung des biologischen Landbaus ist entscheidend von der Arbeit der Anbauverbände geprägt. Ziel der Anbauverbände ist die Förderung der biologischen Wirtschaftsweise. Die Aufgaben der Bioverbände sind im wesentlichen:
- Beratung und Betreuung der Mitglieder in fachlichen Fragen (Anbauberatung, Vermarktungsberatung, ....);
- Richtlinienentwicklung;
- Vergabe der Verbandszeichen nach positiver Kontrolle und Zertifizierung auf der Basis der gesetzlichen Regelungen; sowie auf Basis der privatrechtlichen Regelungen des Verbandes;
- Informationsarbeit über Biolandbau und den Verband für Konsumenten;
- Hilfestellung bei der Vermarktung;
- Interessensvertretung und politisches Lobbying
Die Richtlinien der Verbände sind privatrechtliche Regelungen, die zusätzliche, freiwillig strengere Elemente zu den staatlichen Richtlinien[1] darstellen. Derzeit gibt es in Österreich 12 Bio-Verbände. Seit 2005 wird am Zusammenschluss aller Verbände in einem gemeinsamen Netzwerk (Bio Austria) gearbeitet. Der internationale Dachverband der biologischen Landbaubewegung ist die IFOAM.
Mit Stand Ende 2003 waren in Österreich 13.692 der 19.056 Biobetriebe in Verbänden organisiert. Die restlichen 5.364 Biobetriebe sind nicht Mitglieder eines Bioverbandes (Daten aus Statistik Bio Austria). Sie halten sich an die EU-Bio-Verordnung 2092/91[2] und an den österreichischen Lebensmittelcodex[3], Kapitel A.8, also an die gesetzlichen Mindestbestimmungen zur Biologischen Landwirtschaft.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2
[2] Siehe Kapitel 2.1
[3] Siehe Kapitel 2.2
Inhaltsverzeichnis
Nächstes Kapitel: 9.1 Bioverbände in Österreich
Vorheriges Kapitel: 9 Bioverbände
9.1 Bioverbände in Österreich
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
In Österreich gab es bis Ende des Jahres 2004 mehrere Anbauverbände des biologischen Landbaus, die in zwei Dachverbänden organisiert sind. Unter dem Dachverband ARGE Biolandbau haben sich folgende Verbände zusammengeschlossen:
- Bio Ernte Austria
- Demeter
- ORBI - Förderungsgemeinschaft für gesundes Bauerntum
- Biolandwirtschaft Ennstal
- BAF - Biologische Ackerfrüchte
- Freiland Verband
- Hofmarke
Der zweite Dachverband ist die ÖIG - Österreichische Interessensgemeinschaft für biologische Landwirtschaft, mit folgenden Mitgliedsverbänden:
- Erde&Saat
- Kopra - Konsumenten-Produzenten-Arbeitsgemeinschaft
- Ökowirt
- Organisch-Biologischer Landbau Weinviertel
- Arche Noah
- File:Jpg110x161px
Ab dem Jahr 2005 ist Bio Austria[1], ein gemeinsames Netzwerk, die Aktivitäten aller österreichischen Bioverbände koordinieren. ARGE Biolandbau, ÖIG und der Ernte Bundesverband (die Bundesorganisation der Ernte Landesverbände) sollen mit der Gründung von Bio Austria in Bio Austria übergehen. Durch diesen Zusammenschluss erhofft man sich eine bessere Position gegenüber Marktpartnern, eine bessere Interessensvertretung in der Politik und mehr Klarheit für KonsumentInnen (z.B. durch ein gemeinsames Bio-Zeichen und eine neue Konsumentenzeitschrift).
Quelle: www.bio-austria.at, www.umweltbundesamt.at[2]], www.oekoland.at[3]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.bio-austria.at
[2] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.umweltbundesamt.at
[3] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.oekoland.at
Nächstes Kapitel: 9.2 IFOAM- der internationale Dachverband
Vorheriges Kapitel: 9.1 Bioverbände in Österreich
9.2 IFOAM- der internationale Dachverband
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Das internationale Netzwerk der biologischen Landbauverbände ist die IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). Die IFOAM stellt eine internationale Plattform dar, der neben Bio-Anbauverbänden auch Händler, Verarbeiter, Kontrollorganisationen und andere Organisationen der Biolandbaubewegung angehören. Zu den Aufgaben der IFOAM zählen z.B.:
- Entwicklung und internationale Abstimmung der Richtlinien
- Politische Interessensvertretung (z.B. in der UNO)
- Informationsaustausch (z.B. Publikationen, Organisation von Tagungen, Fachmessen, etc.)
- Förderung von Forschung, Bildungsarbeit und Beratung
- Entwicklung des Marktes von Bioprodukten
Quelle: www.ifoam.org[1], Herrman und Plakolm 1993
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.ifoam.org
Vorheriges Kapitel: 9.2 IFOAM- der internationale Dachverband
10 Konsumenteninformation
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Gerade im Bereich der biologischen Landwirtschaft ist die Information der KonsumentInnen von besonderer Wichtigkeit. Nach wie vor gibt es in der Bevölkerung viele Fragen und Unklarheiten bezüglich der biologischen Wirtschaftsweise. Die wichtigste Anlaufstelle für Konsumentenfragen ist in Österreich die "Bio-Information"[1] der ARGE Biolandbau.
Die Konsumenteninformation von Bio-Austria bietet Wissenswertes zur biologischen Wirtschaftsweise und zu Produkten, Ernährungsberatung, Kochrezepte, Kontrollmechanismen und Kennzeichnung. Auf der website gibt es darüber hinaus eine Datenbank zu Einkaufsquellen für Bio-Produkte. Es gibt gratis Broschüren, ein Journal und die Möglichkeit sich über das Servicetelefon auch persönlich beraten zu lassen.
Information zu Bio-Produkten und damit verbundenen Fragen bieten auch diverse konsumentenorientierte Beratungsstellen und Umweltschutzorganisationen wie z.B. die Umweltberatung[2]], die Arbeiterkammer[3]], der Verein für Konsumenteninformation[4]] (VKI),Global 2000[5], etc. Es gibt auch spezielle websites zum Thema, wie z.B. www.biolebensmittel.at[6] von brainbows (Monika Langthaler) oder www.bio-erleben.at[7] der AMA.
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.bioinformation.at
[2] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.umweltberatung.at
[3] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.arbeiterkammer.at
[4] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.konsument.at
[5] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.global2000.at
[6] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.biolebensmittel.at
[7] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.bio-erleben.at
Vorheriges Kapitel: 10 Konsumenteninformation
11 Aktuelle Entwicklungen
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Aktuelle Entwicklungen der Biologischen Landwirtschaft betreffen derzeit z.B. die Erweiterung der Produktpalette. Die Palette der Bioprodukte weitet sich laufend aus. Verstärkt werden fair gehandelte Produkte (sogenannte "Fair Trade"-Produkte) auch in biologischer Qualität angeboten. Auch Naturkosmetika[1], die aus biologisch produzierten Rohstoffen hergestellt werden, sind für die Konsumenten immer leichter erhältlich. Das selbe gilt für Naturtextilien[2], deren Rohstoffe nach den Richtlinien der Biologischen Landwirtschaft produziert werden, und die in Österreich vor allem über den Versandhandel erhältlich sind. Eine neue Entwicklung ist auch das Angebot von alten Kulturpflanzensorten in Bio-Qualität ("Sortenraritäten" - ein Projekt der Arche Noah, Verein zur Erhaltung und Verbreitung der Kulturpflanzenvielfalt).
Zunehmend werden Bioprodukte in Dienstleistungsbetrieben eingesetzt. Beispiele dafür sind: Biohotels[3], Bioregionen und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung. In der Verpflegung von PensionistInnen in Heimen, Kindern in Schulen oder PatientInnen in Krankenhäusern mit Speisen aus biologischer Landwirtschaft liegt ein grosses Absatzpotential, aber auch ein wichtiger gesellschaftspolitischer Auftrag. Die so genannte Gemeinschaftsverpflegung mit Bioprodukten[4] wird daher derzeit intensiv weiterentwickelt. Aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit Politik und Meinungsbildung sind beispielsweise das österreichische Bioaktionsprogramm oder die Bioaktionstage.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 4.4.1
[2] Siehe Kapitel 4.4.2
[3] Siehe Kapitel 6.4
[4] Siehe Kapitel 6
Inhaltsverzeichnis
Weitere Kapitel dieser Lernunterlage
1 Was ist Biologische Landwirtschaft?
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Gründerväter
4 Produktpalette
5 Vermarktungsformen
6 Gastronomie und Grossküchen
7 Erzeuger
8 Aufbereiter (Verarbeiter)
9 Bioverbände
10 Konsumenteninformation
12 Diskussionsfelder
13 Glossar
14 Quellen
Nächstes Kapitel: 11.1 Sortenraritäten
Vorheriges Kapitel: 11 Aktuelle Entwicklungen
11.1 Sortenraritäten
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
"Vielfalt auf den Teller!" ist das Motto des Projektes "Netzwerk für Anbau und Vermarktung von Sortenraritäten aus Biologischem Anbau". Das Netzwerk besteht aus rund 40 Biobetrieben, die mit ihrem Angebot an Sortenraritäten in einer Datenbank erfasst sind. Sortenraritäten sind alte Gemüse-, Obst- und Getreidesorten, eigene Selektionen, Lokalsorten, fremdländische Sorten und vergessene Kulturpflanzenarten aus Mitteleuropa. Die Vielfalterdatenbank umfasst Adressen von Biobetrieben, die diese Sorten anbieten, ihr saisonelles Angebot und Sortenporträts. Ziel des vom BMLFUW geförderten Projektes ist es,
- Biobetriebe, KonsumentInnen, Verarbeitungsbetriebe, Vermarkter und den Fachhandel zu vernetzen
- Biobetriebe beim Anbau und der Vermarktung der Sortenraritäten zu unterstützen
- Wissen und Erfahrungen zu Anbau und Pflege, Ernte und Lagerung, Verarbeitung und Zubereitung von Sortenraritäten zu sammeln und weiterzugeben (Sortenraritäten Infobörse) und
- KonsumentInnen für Sortenraritäten zu begeistern.
Das Projekt wurde von der Arche Noah, einem Verein der sich für die Erhaltung und Förderung alter Kulturpflanzensorten einsetzt, initiiert und geleitet.
Quelle: www.arche-noah.at[1]
Ein Beispiel für einen Betrieb, der bereits seit mehreren Jahren sehr erfolgreich alten Kulturpflanzensorten anbaut, verarbeitet und vermarktet, ist der Betrieb der Familie Stekovics. Auf dem Bio-Betrieb in Frauenkirchen im Burgenland gedeihen Paradeiser, Paprika und anderes Gemüse im Freiland, nicht im Folientunnel. Die gesamte Vielfalt an Paradeisersorten wird alljährlich im Rahmen des Paradeiserfestivals präsentiert: 3.000 Sorten aus der ganzen Welt können am Feld und im Schaugarten bewundert werden. Im Jahr 2005 gibt es zum ersten Mal auch ein Chilifestival, wo 300 Sorten von Chili und Gemüsepaprika zu sehen (und kosten) sind. Der Betrieb verarbeitet das Gemüse selbst und exportiert in die ganze Welt. Ein Auszug aus der Produktpalette: eingelegt Gelbe Johannesbeerparadeiser, Dattelwein-Paradeis, Saures Paradeiserkompott, Paradeisersugo, Paradeiskonfitüre, Salzgurken, eingelegte Zucchini, Chilikonfitüre, Mieze-Schindler-Erdbeerkonfitüre, ...
Quelle: www.stekovics.at[2]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.arche-noah.at
[2] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.stekovics.at
Nächstes Kapitel: 11.2 Fair Trade und Biolandbau
Vorheriges Kapitel: 11.1 Sortenraritäten
11.2 Fair Trade und Biolandbau
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Fair Trade ist die Bezeichnung einer Handelsform, bei der Produkte auf möglichst kurzem Weg (wenig Zwischenhändler) vom Produzenten zum Konsumenten gebracht werden sollen und den Produzenten faire Preise - über dem Weltmarktpreis und unabhängig vom Weltmarktpreis - zugesichert sind.
Von der FLO (Fairtrade Labeling Organizations International) wurden Kriterien des fairen Handels festgelegt. Um mit dem internationalen Prüfzeichen "TransFair- FairTrade" ausgezeichnet zu werden, muß die Einhaltung der Kriterien von einer unabhängigen Kontrollstellezertifiziert sein. TransFair-Richtlinien existieren für Kaffee, Tee, Schokolade, Bananen, Honig, Zucker, Reis, Säfte, Weine, Fußbälle. Das TransFair-Zeichen ist keine Marke und die Dachorganisation FLO sowie die nationalen Organisationen handelt auch selbst nicht mit Waren, sondern zeichnet Produkte aus, die nach den festgelegten Bedingungen gehandelt wurden.
Der Gedanke von Fairem Handel hat sich mit dem Gedanken des Biolandbaus verbunden, insbesondere bei der Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten (Rohstoffe für Lebensmittel und für Textilien) in den Ländern Afrikas, Lateinamerikas und Asiens. So sind nun zunehmend Produkte aus Biolandbau am Markt zu finden, die gleichzeitig nach den Richtlinien von FairTrade produziert und gehandelt werden. FairTrade Produkte und FairTrade & Bio-Produkte sind in EZA-Läden, Naturkostläden und auch in Supermarktketten erhältlich.
Quellen: www.fairtrade.at[1]], www.transfair.org[2]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.fairtrade.at
[2] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.transfair.org
Inhalt
11.2.1 Internationale FairTrade-Kriterien
Von der FLO (Fairtrade Labeling Organizations International) wurden Kriterien des fairen Handels festgelegt, die erfüllt werden müssen um mit dem internationalen Prüfzeichen "TransFair- FairTrade" zertifiziert zu werden. Die Kriterien müssen sowohl von den zertifizierten Importeuren als auch von den ProduzentInnen eingehalten werden. Für zertifizierte Importeure gelten u.a. folgende Richtlinien:
- Zahlung fester Mindestpreise, die unabhängig von den Preisschwankungen auf den Märkten zu zahlen sind
- Zahlung einer Fair-Trade-Prämie an die Kooperativen für soziale und ökologische Projekte
- direkter Einkauf bei den ProduzentInnen
- Aufbau einer langfristigen Handelsbeziehung.
Für die ProduzentInnen gelten u.a. folgende Regeln:
- Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit
- Förderung von kleinbäuerlichen Erzeugergemeinschaften
- Einhaltung internationaler Arbeitsschutzabkommen wie Sozialversicherung, Zahlung von Tariflöhnen, gewerkschaftliche Organisation
- Förderung eines umweltverträglichen Anbaus: weitgehender Verzicht auf Pestizide, Erosions- und Trinkwasserschutz, Abwasserreinigung. Bei Fair Trade Bioprojekten: 100 % Einhaltung der Gesetze und Richtlinien für den Biolandbau.
FairTrade-Richtlinien existieren für folgende Rohstoffe bzw. Produkte: Kaffee, Tee, Schokolade, Bananen, Honig, Zucker, Reis, Säfte, Weine, Fußbälle.
Quelle: www.fairtrade.at[1]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.fairtrade.at
Nächstes Kapitel: 11.3 Bioregionen
Vorheriges Kapitel: 11.2 Fair Trade und Biolandbau
11.3 Bioregionen
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Das Konzept der Bio-Region als Verbindung nachhaltiger, regionaler Entwicklung und Biologischer Landwirtschaft gewinnt in der Praxis zunehmend an Bedeutung. In Österreich gibt es laufend neue Initiativen zur Errichtung von Bioregionen. Bioregionen streben eine Vernetzung der biologischen Landwirtschaft mit anderen Wirtschaftssektoren (z.B. Tourismus oder Gastronomie) einer Region an. Neben dieser vertikalen Vernetzung innerhalb einer Region wird auch eine stärkere Zusammenarbeit der Bio-Betriebe untereinander angestrebt (horizontale Vernetzung). Die regionalen Austauschbeziehungen innerhalb der Biologischen Landwirtschaft sowie zu den anderen Wirtschaftsbereichen sind stärker ausgeprägt als in vergleichbaren Regionen. Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung beschränkt sich somit in der Bioregion nicht nur auf die Landwirtschaft, sondern umfasst alle tragenden Wirtschaftssektoren einer Region.
Unterschiedliche Meinungen gibt es bezüglich der "Vollumstellung" einer Region auf biologische Landwirtschaft als Ziel einer Entwicklung zur Bio-Region. Die praktischen Zugänge zur Errichtung einer Bioregion sind ebenfalls sehr unterschiedlich. Es gibt Bioregionen, die sehr stark auf Produkte orientiert sind, Bioregionen, die mehr die gesamte Region in den Vordergrund stellen und Bioregionen, die möglichst eine flächendeckende Umstellung auf Biologische Landwirtschaft anstreben.
Aufgrund der unterschiedlichen Ansätze in der Praxis und unterschiedlichen Zielvorstellungen für Bioregionen ist die Schaffung von offiziellen Richtlinien und die Anerkennung von Bioregionen zwar von vielen Praktikern gewünscht und in Diskussion, jedoch noch nicht praxisreif.
Quellen: Schermer und Kratochvil 2003, Kratochvil 2004.
Nächstes Kapitel: 11.4 Politik und Meinungsbildung
Vorheriges Kapitel: 11.3 Bioregionen
11.4 Politik und Meinungsbildung
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
In der Politik werden Maßnahmen gesetzt, um den Biolandbau in die gewünschte Richtung zu entwickeln. Ein Beispiel dafür ist die Formulierung des Österreichischen Bioaktionsprogrammes. Ausgehend davon wird Meinungsbildung in der Öffentlichkeit betrieben. Ein Beispiel dafür sind die Bioaktionstage, eine Info-Offensive der AMA Marketing GesmbH und Bio Austria.
Inhalt
11.4.1 Österreichisches Bioaktionsprogramm
Das Aktionsprogramm für die Biologische Landwirtschaft des Lebensministeriums (BMLFUW) ist eine konkrete politische Willenserklärung, die Biologische Landwirtschaft und ihre Erzeugnisse zu fördern. Es ist zweijährig und wurde das erste Mal 2001/2002 umgesetzt und 2003- 2004 fortgesetzt.
Das Bio-Aktionsprogramm enthält allgemeine Vorgaben und einen Maßnahmenteil, in dem jene Förderungsmaßnahmen gelistet sind, die in den jeweiligen Jahren umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen betreffen insbesonders die Bereiche Bildung, Schulen, Beratung, Forschung, Vermarktung, Öffentlichkeitsarbeit und Kontrolle (Qualitätssicherung). Kernthemen des aktuellen Aktionsprogrammes sind:
- die Förderung eines Biokompetenzzentrums,
- neue Vermarktungsstrategien,
- eine noch effizientere Qualitätssicherung und
- zusätzliche Anstrengungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.
Als Ziele wurden folgende Punkte definiert:
- Die Position als EU-Bioland Nr. 1 (gemessen am Anteil der biologisch bewirtschafteten Flächen) soll weiter erhalten werden.
- Das biologisch bewirtschaftete Ackerland soll im Jahr 2004 zumindest 105.000 Hektar und im Jahr 2006 zumindest 115.000 Hektar betragen. Die Verbesserung der Beratungsaktivitäten der Bioverbände und Landwirtschaftskammern sowie der Bio-Kompetenz der landwirtschaftlichen Schulen soll in diesem Zusammenhang einen wichtigen Beitrag liefern.
- Es sollen diejenigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass alle biologisch erzeugten Produkte auch biologisch vermarktet werden. Speziell im Grünland sind besondere Anstrengungen zu unternehmen, um die Nachfrage nach Bio-Milch zu erhöhen und damit die noch immer bestehende Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen.
- Das Marktvolumen an gehandelten Bioprodukten soll durch eine Verbesserung der Vermarktungsstrategien und der Öffentlichkeitsarbeit sowie einer weiteren Steigerung der Effizienz der Kontrolle und der Qualitätssicherung bis 2004 von den bestehenden 3 % um ein Drittel erhöht werden.
Quelle: www.lebensministerium.at/land[1]
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.lebensministerium.at/land
11.4.2 Bioaktionstage
Unter dem Titel: "I love bio" - Bioaktionstage 2004 wurden im September 2004 zahlreiche Aktionen zur Biolandwirtschaft in Österreich durchgeführt. Diese Aktionstage stellen eine Info- Offensive der AMA Marketing GesmbH und BIO Austria, dem neu gegründeten Bioverband Österreichs, dar. Das Kernthema des Projektes ist eine umfassende KonsumentInneninformation. In diesen Bio-Aktionstagen tourten MitarbeiterInnen der BioInfo, dem österreichischen Informationsservice für KonsumentInnen zum Thema Bio, durch Österreich. Es wurden Verkostungen, Gewinnspiele und umfangreiche Informationsmöglichkeiten geboten. Außerdem luden zahlreiche Biobetriebe zu einem Tag der offenen Tür oder veranstalteten Hoffeste.
Vorheriges Kapitel: 11.4 Politik und Meinungsbildung
12 Diskussionsfelder
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Akteure der biologischen Landwirtschaft diskutieren u.a. kontroversiell über folgende Themen:
Inhaltsverzeichnis
Weitere Kapitel dieser Lernunterlage
1 Was ist Biologische Landwirtschaft?
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Gründerväter
4 Produktpalette
5 Vermarktungsformen
6 Gastronomie und Grossküchen
7 Erzeuger
8 Aufbereiter (Verarbeiter)
9 Bioverbände
10 Konsumenteninformation
11 Aktuelle Entwicklungen
13 Glossar
14 Quellen
Nächstes Kapitel: 12.1 Regional versus Global im Biolandbau
Vorheriges Kapitel: 12 Diskussionsfelder
12.1 Regional versus Global im Biolandbau
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Akteure der Biologischen Landwirtschaft diskutieren Globalisierung beispielsweise mit folgenden Argumenten:
Pro Regional: Die Energieeffizienz der biologischen Landwirtschaft und die Schließung von Stoffkreisläufen können am besten über eine optimale Vernetzung regionaler Akteure, über regionale Wertschöpfung und regionale Vermarktung sichergestellt werden. Hierbei könnte ein z.B. eine Westungarische Biomarille in einer burgenländischen Biomarillenmarmelade (trotz der Überschreitung von Grenzen) ein "regionalerer" Rohstoff sein, als Voralberger Bergkäse in einem Wiener Restaurant. Dagegen würden nach dieser Betrachtungsweise Chilenischer Biowein in Niederösterreich als nicht regional betrachtet werden.
Pro Global: Internationale solidarische Verantwortung, insbesondere mit Entwicklungsländern, müsste dazu führen, eine nachhaltige Produktion von Lebensmitteln in diesen Ländern, sowie entsprechende Aufbereitungsstrukturen zu fördern. Dies schliesst ein, für Bioprodukte aus diesen Ländern einen Markt zu schaffen und sie, trotz weiter Transportwege, auch in entfernteren Regionen mit höherer Kaufkraft abzunehmen.
Pro Global: Aufgrund der begrenzten Nachfrage nach Bioprodukten in Mitteleuropa ist es für die heimischen BiobäuerInnen förderlich, nach neuen internationalen Absatzwegen zu suchen. Dies sichert eine nachhaltige Landwirtschaft.
Fragen: Wie beurteilen Sie österreichisches Bio-Schweinefleisch in Japan?
Wie beurteilen Sie griechischen Biowein in Österreich?
Nächstes Kapitel: 12.2 Externe Effekte der Landwirtschaft
Vorheriges Kapitel: 12.1 Regional versus Global im Biolandbau
12.2 Externe Effekte der Landwirtschaft
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Der Biologische Landbau gilt als jene Form der Landbewirtschaftung, die die geringsten negativen externen Umwelteffekte hat. Unter "Externalisierung von negativen Umwelteffekten" wird verstanden, dass nicht (nur) die Verursacher die negativen Folgen ihres Handelns tragen, sondern andere (in der Regel die Gesellschaft) hierfür aufkommen muss. So tragen beispielsweise in manchen Regionen nicht die Anwender von toxischen Herbiziden (Unkrautvernichtungsmitteln) die Folgen der Belastung des Grundwassers mit diesen Herbiziden, sondern die Wasserverbraucher. Mit dem höheren Wasserpreis, den diese Verbraucher zahlen müssen, werden die Herbizid-Reinigungsanlagen in jenen Wasserwerken bezahlt, die die Verbraucher mit Wasser versorgen. Weitere Beispiele sind:
- Belastung von Lebensmitteln mit toxischen Rückständen: Die Kosten der notwendigen Analytik tragen in der Regel die Verbraucher, über Produktpreise und Steuern;
- Emmission von Kohlendioxyd bei der Herstellung von Betriebsmitteln, wie z.B. Stickstoffdünger, oder Emmissionen von Abgasen und Lärm bei internationalem Transport von Produkten: Die Kosten für Reperaturmassnahmen (Lärmschutzwände, Behandlung von Kranken) trägt die Gesellschaft.
Da im Biologischen Landbau toxische Betriebsmittel verboten sind, sowie eine schonende Bewirtschaftung vorgeschrieben ist (Fruchtfolge, organische Düngung, etc.) ist das Risiko für negative Umwelteffekte gering. Trotzdem werden im Biologischem Landbau folgende Punkte kontroversiell diskutiert:
- Internationaler Transport von Bioprodukten
- Internationaler Transport von organischen Betriebsmitteln
Nächstes Kapitel: 12.3 Wertewandel
Vorheriges Kapitel: 12.2 Externe Effekte der Landwirtschaft
12.3 Wertewandel
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Der Biologische Landbau ist nicht nur - rein technisch gesehen - eine Form der Landbewirtschaftung nach strengen Richtlinien, oder - neoliberal gesehen - eine "Marktentwicklung", sondern auch eine soziale Bewegung, die in ihrer Entstehung durch verschiedene Ideale geprägt war, wie z.B.:
- vollwertige, gesunde Ernährung;
- alternative sozialverträgliche Lebensweise;
- schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen;
Frage: Kennen Sie weitere Ideale aus der Geschichte des Biologischen Landbaus?
Seit dem Boom in der Nachfrage nach Bioprodukten in den 90er Jahren hat sich ein merklicher Imagewandel vollzogen: Wurde "Bio" früher mit einer bestimmten Ernährungsideologie, besonders mit Vollwert- und vegetarischer Ernährung in Verbindung gebracht, so steht heute der Genuss und der Wunsch nach "wohltuenden", gesunden Lebensmitteln im Vordergrund. Die Einführung von Bio-Convenience-Produkten trägt außerdem den geänderten Lebensbedingungen Rechnung, in denen der Faktor Zeit immer wichtiger und knapper wird. Greift man zu Bio- Fertigprodukten, muss man nicht auf Bioqualität und hochwertige Rohstoffe verzichten.
Dieser Wandel im Bio-Konsum ist heute ein wesentlicher Diskussionspunkt, da er nicht immer mit den Idealen und Prinzipien der biologischen Landwirtschaft im Einklang steht. Kontroversiell wird auf der Seite der Akteure des Biologischen Landbaus diskutiert, ob:
- diese Ideale für die Weiterentwicklung des Biolandbaus heute noch sinnvoll sind;
- sie durch die aktuelle Entwicklung (finanzielle Förderungen für Biobauern; Handel von Bioprodukten durch Supermärkte) unterstützt oder untergraben werden.
Nächstes Kapitel: 12.4 Unternehmertum - Verunternehmerisierung
Vorheriges Kapitel: 12.3 Wertewandel
12.4 Unternehmertum - Verunternehmerisierung
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Die Entwicklung des Biologischen Landbaus ist auf der Seite der Erzeuger duch kleinbäuerliche, gemischte Betriebe, sowie auf der Seite der Aufbereitung durch gewerbliche, meist kleinere engagierte Verarbeitungsbetriebe gekennzeichnet. Charakteristisch hierfür sind in der Regel eine große Nähe der Akteuere i) zueinander, ii) zur Region, in der die Produkte hergestellt wurden und iii) zu den Konsumenten.
Die starke Nachfrage der Kunsumenten nach Bioprodukten hat dazu geführt, dass nun große landwirtschaftliche Betriebe sowie international agierende Nahrungsmittelkonzerne in Erzeugung, Aufbereitung und Handel von Bioprodukten involviert sind. Kontroversiell diskutiert wird, ob
- die Akteure des Biolandbaus diesen Trend zur "professionellen", "zeitgemäßen", "marktorientierten" unternehmerischen Erzeugung und Aufbereitung von Bioprodukten mit gehen müssen,
- oder als eine Art "Kontrapunkt" alternative Sozial- und Wirtschaftsformen aufbauen bzw. erhalten sollen, wie z.B. Erzeuger-Verbrauchergemeinschaften, Tauschkreise, etc.
Nächstes Kapitel: 12.5 Wettbewerb - Preise
Vorheriges Kapitel: 12.4 Unternehmertum - Verunternehmerisierung
12.5 Wettbewerb - Preise
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Die zunehmende Nachfrage, aber auch das zunehmende Angebot von Bioprodukten führen am Markt zu einer stärkeren Konkurrenz zwischen
- Bioprodukten unterschiedlicher Hersteller und Erzeuger;
- Bioprodukten und konventionellen Produkten (hier insbesondere konventionellen Produkten aus sogenannten "Markenprogrammen", die mit einer "besonderen" Qualität werben).
Kontroversiell diskutiert werden die Auswirkungen dieses Wettbewerbes auf die Produktqualität bzw. Prozessqualität von Bioprodukten. Argumente, die hier genannt werden sind:
- Der Wettbewerb führe in der Regel dazu, dass der Lebensmittelhandel nun stärker konventionelle Parameter der Produktqualität (Klasse, Färbung, etc.) von Bioprodukten für die Beurteilung der Vermarktbarkeit und der Preisgestaltung heranzieht, jedoch nicht für Biolandbau charakteristische Parameter (Geschmack, Regionalität, etc.)
- Die Werbung stelle stärker durch die Marktforschung gegebene Eigenschaften in den Vordergrund (Genuss, Lifstyle) und nicht Charakteristika der Produktionsweise (vielfältige Kulturlandschaft, positive Umweltauswirkungen, etc.).
- Biobauern würden zu Konkurrenten untereinander, während es doch eine Konkurrenz zwischen Biolandbau und konventionellem Landbau geben müsse, nach Regeln von Politik und Marktpartnern, die jene Form der Landwirtschaft begünstigen möge, die positivere Umwelt- und Sozialauswirkungen (Sauberes Grundwasser; höheren Arbeitskraftbedarf) habe.
Fragen: Kennen Sie weitere Argumente aus dieser Debatte? Welche Argumente hätten Sie?
Vorheriges Kapitel: 12.5 Wettbewerb - Preise
13 Glossar
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Begriffe, die im Zusammenhang mit dem Thema Biolandbau und Markt immer wieder erwähnt werden, werden kurz erklärt.
Inhaltsverzeichnis
Weitere Kapitel dieser Lernunterlage
1 Was ist Biologische Landwirtschaft?
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Gründerväter
4 Produktpalette
5 Vermarktungsformen
6 Gastronomie und Grossküchen
7 Erzeuger
8 Aufbereiter (Verarbeiter)
9 Bioverbände
10 Konsumenteninformation
11 Aktuelle Entwicklungen
12 Diskussionsfelder
14 Quellen
Nächstes Kapitel: 13.1 Biologische Landwirtschaft
Vorheriges Kapitel: 13 Glossar
13.1 Biologische Landwirtschaft
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Der Begriff "Biologische Landwirtschaft"[1] bezeichnet eine alternative Wirtschaftsform innerhalb der Landwirtschaft. Sie ist durch rechtliche Rahmenbedingungen[2] geregelt.
Eines der wichtigsten Kennzeichen der Biologischen Landwirtschaft ist die ganzheitliche Betrachtung des landwirtschaftlichen Betriebes (Herrmann, Plakolm 1991). Natürliche Lebensprozesse sollen gefördert und Stoffkreisläufe weitgehend geschlossen werden. In der Praxis bedeutet das:
- Verbot der Anwendung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel und leicht löslicher Mineraldünger
- Förderung der Gesundheit und Fruchtbarkeit des Bodens durch schonende Bodenbearbeitung, natürliche Düngemittel und eine ausgewogene Fruchtfolge
- Förderung der natürlichen Selbstregulationsmechanismen eines intakten Ökosystems
- Verbot des Einsatzes von Gentechnik in allen Bereichen des Bio-Landbaus
- Artgerechte Tierhaltung, Fütterung mit biologisch produziertem Futter
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 1
[2] Siehe Kapitel 2
Nächstes Kapitel: 13.2 Pflanzenschutzmittel
Vorheriges Kapitel: 13.1 Biologische Landwirtschaft
13.2 Pflanzenschutzmittel
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
In der konventionellen Landwirtschaft werden chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel eingesetzt um Unkräuter, Krankheiten und Schädlinge zu bekämpfen. Diese toxischen Substanzen schädigen jedoch nicht nur die beabsichtigten Organismen, sondern auch Nützlinge und Bodenorganismen. Sie kontaminieren die Umwelt und gefährden entweder durch direkten Kontakt oder durch die Belastung der Nahrungskette die Gesundheit des Menschen.
Im biologischen Landbau werden zum Schutz der Kulturpflanzen vorbeugende Maßnahmen eingesetzt, wie z.B. Fruchtfolgegestaltung oder Standort- und Sortenwahl. Ziel des Biologischen Landbaus ist es, Pflanzen so anzubauen, dass ein Befall durch Schädlinge oder Krankheiten bzw. die Konkurenz durch andere Pflanzen keine oder nur geringe Auswirkungen hat. Direkte Maßnahmen sind z.B. mechanische Verfahren in der Unkrautregulierung, der Einsatz von Nützlingen oder das Ausbringen von pflanzlichen Präparaten, die biologisch abbaubar sind.
Nächstes Kapitel: 13.3 Ökologischer Landbau
Vorheriges Kapitel: 13.2 Pflanzenschutzmittel
13.3 Ökologischer Landbau
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Ökologischer Landbau ist ein Synonym für Biologische Landwirtschaft.
Vorheriges Kapitel: 13.3 Ökologischer Landbau
13.4 ÖPUL
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
ÖPUL = Österreichisches Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft. Das ist der vollständige Name des österreichischen Agrar-Umweltprogranmmes. Das Programm wird vom Bund gemäß "Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 des Rates vom 30. Juni 1992 für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren" im gesamten Bundesgebiet angeboten.
Die wichtigsten Ziele des österreichischen Umweltprogramms sind die Beibehaltung bzw. Umsetzung einer umweltgerechten Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt sowie die Erhaltung des natürlichen Lebensraumes. Weiters werden landwirtschaftliche Produktionsverfahren gefördert, welche die umweltschädigenden Auswirkungen der Landwirtschaft verringern helfen, was gleichzeitig zu einer Verbesserung des Marktgleichgewichtes beiträgt. Es soll weiters die Extensivierung der pflanzlichen und tierischen Produktion fördern und einen Anreiz für die langfristige Stilllegung von landwirtschaftlichen Flächen und Pflegemaßnahmen aus Gründen des Umweltschutzes bieten. Die Sicherung angemessener Einkommen in der Landwirtschaft sowie die Sensibilisierung und Ausbildung der Landwirte bezüglich der Belange des Umweltschutzes und der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes sind weitere Schwerpunkte des ÖPUL (www.gruener-bericht.at[1]).
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.gruener-bericht.at
13.5 AMA
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
AMA ist die Abkürzung für Agrarmarkt Austria[1]. Die AMA wurde vom Gesetzgeber als juristische Person des öffentlichen Rechts eingesetzt. Ihre Aufgaben sind die Verwaltung der EU- Marktordnungen und Agrarmarketing.
Verweise:
[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.ama.at
Nächstes Kapitel: 13.6 Fruchtfolge
13.6 Fruchtfolge
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Unter Fruchtfolge versteht man den Wechsel von verschiedenen Kulturpflanzenarten. Bei der Fruchtfolgegestaltung werden Pflanzen mit unterschiedlichen Ansprüchen bzw. Auswirkungen für den Boden in zeitlicher Abfolge auf einem Feld kombiniert (so gibt es z.B. Pflanzen, die viel Stickstoff brauchen und Pflanzen, die in der Lage sind Stickstoff aus der Luft zu binden und im Boden einzulagern). Das wichtigste Ziel der Fruchtfolgegestaltung ist die Fruchtbarkeit des Bodens nachhaltig zu erhalten.
Nächstes Kapitel: 13.7 Bioverband
Vorheriges Kapitel: 13.6 Fruchtfolge
13.7 Bioverband
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Ein Bioverband[1] ist ein privatrechtlicher Zusammenschluss von biologisch wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betrieben, wobei je nach Verband z.B. auch Verarbeiter oder KonsumentInnen Mitglieder sein können.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 9
Nächstes Kapitel: 13.8 Erzeuger
Vorheriges Kapitel: 13.7 Bioverband
13.8 Erzeuger
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Erzeuger[1] von biologischen Produkten sind landwirtschaftliche Betriebe[2], die nach den gesetzlichen Richtlinien zur biologischen Landwirtschaft produzieren.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 7
[2] Siehe Kapitel 7.1
Nächstes Kapitel: 13.9 Kontrolle
Vorheriges Kapitel: 13.8 Erzeuger
13.9 Kontrolle
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Biobetriebe werden mindestens einmal pro Jahr von staatlich authorisierten Organisationen (Kontrollstellen[1]) auf Einhaltung der Produktionsrichtlinien kontrolliert. Siehe auch Rechtliche Regelungen[2].
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2.4
[2] Siehe Kapitel 2
Nächstes Kapitel: 13.10 Zertifizierung
Vorheriges Kapitel: 13.9 Kontrolle
13.10 Zertifizierung
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Die Zertifizierung ist das Ergebnis einer erfolgreich abgeschlossenen Kontrolle eines Biobetriebes. Sie bestätigt die Einhaltung der Produktionsrichtlinien. Siehe auch Rechtliche Regelungen[1].
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2
Vorheriges Kapitel: 13.10 Zertifizierung
14 Quellen
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
- BMLFUW 2003: Lebensmittelbericht Österreich. Die Entwicklung des Lebensmittelsektors von 1995 bis 2002. BMLFUW, Wien.
- Dietachmair, Thomas 2004: "Biomarkt im Wandel". In Ernte. Zeitschrift für Landwirtschaft und Ökologie 3/04, S. 16-17.
- Enquete-Kommission des deutschen Bundestages (Hrsg.) 1994: Die Industriegesellschaft gestalten. Perspektiven für einen nachhaltigen Umgang mit Stoff- und Materialströmen. Bericht der Enquete-Kommission "Schutz des Menschen und der Umwelt - Bewertungskriterien und Perspektiven für umweltverträgliche Stoffkreisläufe in der Industriegesellschaft" des 12. Deutschen Bundestages. Bonn: Economica Verlag.
- Hartl, Anna und Vogl, Christian 2001: Faser- und Färbepflanzen aus Ökologischem Landbau. Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung. Bericht aus Energie- und Umweltforschung. Hrsg.: BMVIT, Wien. Band 1a.
- Herrmann, Gerald und Plakolm, Gerhard 1991: Ökologischer Landbau. Grundwissen für die Praxis. Österreichischer Agrarverlag, Wien.
- Kaiblinger, Karin und Zehetgruber, Rosemarie 2004: " ’Bio’ außer Haus". In Ernte. Zeitschrift für Landwirtschaft und Ökologie 3/04, S. 24-26.
- Kratochvil, Ruth 2004: "Beiträge von Bioregionen zur nachhaltigen Regionalentwicklung". In: Kullmann, A. (Hrsg.) 2004: Ökologischer Landbau und nachhaltige Regionalentwicklung. Stragien, Erfolge, Probleme, Handlungs- und Forschungsbedarf. Berichte zur IfLS-Tagung am 11. März 2004 in Frankfurt/Main. Institut für ländliche Strukturfoschung an der Johann Wolfgang Goethe- Universität, Frankfurt/Main. S. 66-78.
- Mayr, Johannes 2004: "Darf es mehr ’bio’ sein?". In Ernte. Zeitschrift für Landwirtschaft und Ökologie 3/04, S. 22-23.
- Omelko, Michael und Schneeberger, Walter 2002: "Bedeutung, Struktur, Potenziale und Hemmnisse der Bioschweinehaltung". In BMLFUW (Hrsg.): Grüner Bericht 2002, Wien. S. 125- 126.
- Pfeiffer, Eva Maria 2005: "Pflanzenöl, ein Schatz für die Gesundheit". In Eve - das Naturkostmagazin. Ausgabe 3, Mai/Juni 2005. S. 6-11.
- Piringer, Markus und Hartl, Anna o.J.: Naturkosmetik. Einkaufsratgeber für Schönheits- und Körperpflege. Hrsg.: Global 2000. Wien.
- Schermer, Markus und Kratochvil, Ruth 2003: "Bio + Region = Bioregion? Ein Workshop im Rahmen der Wissenschaftstagung". Ökoland 1/2003, S. 16-17.
- Schomborg, Heinrich 2004: "Herausforderung Bio-Milch". In Ernte. Zeitschrift für Landwirtschaft und Ökologie 4/04, S. 16-19.
- Ton, Peter 2002: "The 2001 international market for organic cotton and eco-textiles". In Resource Efficiency in the Textile Line. Tagungsband zur "3rd International Conference on Organic Textiles" in Düsseldorf, 7.-9. August 2002. Hrsg.: IMO, Konstanz.
- Umweltberatung (Hrsg.) 2000: Biologisch genießen in großen Küchen. Wege zum erfolgreichen Einsatz von biologischen Lebensmitteln mit vielen Beispielen aus der österreichischen Küchenpraxis. Umweltberatung, Wien.
- Vogl, Christian und Axmann, Paul 2002: "Selbsternte - a new concept of Urban City Farming in Austria". In Urban Agriculture Magazine, Nr. 6, S. 12-14.
- Zehetgruber, Rosemarie 2004: "Bio-Milch: Freiheit, die man schmeckt!". In Ernte. Zeitschrift für Landwirtschaft und Ökologie 4/04, S. 15.
Inhaltsverzeichnis
Weitere Kapitel dieser Lernunterlage
1 Was ist Biologische Landwirtschaft?
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Gründerväter
4 Produktpalette
5 Vermarktungsformen
6 Gastronomie und Grossküchen
7 Erzeuger
8 Aufbereiter (Verarbeiter)
9 Bioverbände
10 Konsumenteninformation
11 Aktuelle Entwicklungen
12 Diskussionsfelder
13 Glossar
Nächstes Kapitel: 14.1 Internetseiten
Vorheriges Kapitel: 14 Quellen
14.1 Internetseiten
verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl
Besuchte Internetseiten:
- https://web.archive.org/web/2005*/http://at.hess-natur.com (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://fotoservice.lebensministerium.at (Nov. 2004)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.innatex.de (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.3klang.info (Nov. 2004)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.adamah.at (Nov. 2004)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.ama.at (Nov. 2004 und Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.arbeiterkammer.at (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.arche-noah.at (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.bergkraeuter.at (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.bio-austria.at (Nov. 2004 und Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.bio-erleben.at (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.biofisch.at (Nov. 2004)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.biohotels.at (Nov. 2004 und Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.biokueche.at (Nov. 2004)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.bioinformation.at (Nov. 2004 und Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.biolebensmittel.at (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.biomarkt.co.at (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.biowichtl.at (Nov. 2004)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.cleanclothes.org (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.consequent.org (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.der-bioladen.de (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.diehoflieferanten.at (Nov. 2004)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.ernte.at (Nov. 2004)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.fairtrade.at (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.global2000.at (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.gruener-bericht.at (Nov. 2004)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.highlandbeef.at (Nov. 2004)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.ifoam.org (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.konsument.at (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.lavera.de (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.lebensministerium.at/land (Nov. 2004)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.logona.com (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.naturkost.de (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.naturtextil.com (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.oekoland.at (Nov. 2004 und Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.orbi-bauernladen.at (Nov. 2004)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.pan-germany.org (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.primavera-life.de (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.ringana.com (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.rudolf-steiner.de (Nov. 2004)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.sanoll.at (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.sekem.com (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.selbsternte.at (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.sonnentor.at (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.stekovics.at (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.styriabeef.at (Nov. 2004)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.transfair.org (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.umweltberatung.at (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.umweltbundesamt.at (Nov. 2004 und Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.weleda.com (Mai 2005)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.wien.gv.at/ma53 (Nov. 2004)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.wien.gv.at/ma59 (Nov. 2004)
- https://web.archive.org/web/2005*/http://www.zillinger.at (Nov. 2004)
Artikel aus dem Internet:
- Bio Ernte Austria 2004: "Bio-Obstbau. Zukunftsperspektiven für Obstbauprofis". Online: https://web.archive.org/web/2005*/http://www.ernte.at/frameinhalte/Kap4_presse/Pressetexte/fi_t_pr_obstbau04.html (Nov. 2004).
- BMLFUW (Hrsg.) 2003: Grüner Bericht 2002. Bericht über die Lage der österreichischen Landwirtschaft 2002. Online: https://web.archive.org/web/2005*/http://www.gruener-bericht.at (Nov. 2004).
- BMLFUW (Hrsg.) 2004: Grüner Bericht 2003. Bericht über die Lage der österreichischen Landwirtschaft 2003. Online: https://web.archive.org/web/2005*/http://www.gruener-bericht.at (Nov. 2004).
- Gruber, Ludwig 2004: "Strategien der Biohotels". Online: https://web.archive.org/web/2005*/http://www.biohotels.info/sixcms/media.php/547/Konzept.16074.pdf (Nov. 2004).
- Vogl, Christian 2003: "Konsolidierte Fassung der EU-Verordnung 2092/91 über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel". 51. ergänzte Auflage vom 12. Mai 2004 (mit Korrekturen vom 25.7.2004). Online: https://web.archive.org/web/2005*/http://www.boku.ac.at/oekoland/MitarbeiterInnen/Vogl/vogl_verordnung2092.htm (Nov. 2004).
- Wirtschaftskammer 2004: "Schwerpunktthema Codex Alimentarius Austriacus". Online: https://web.archive.org/web/2005*/http://dielebensmittel.at/dokumente/schwerpunktthemen/codex.htm (Nov. 2004)